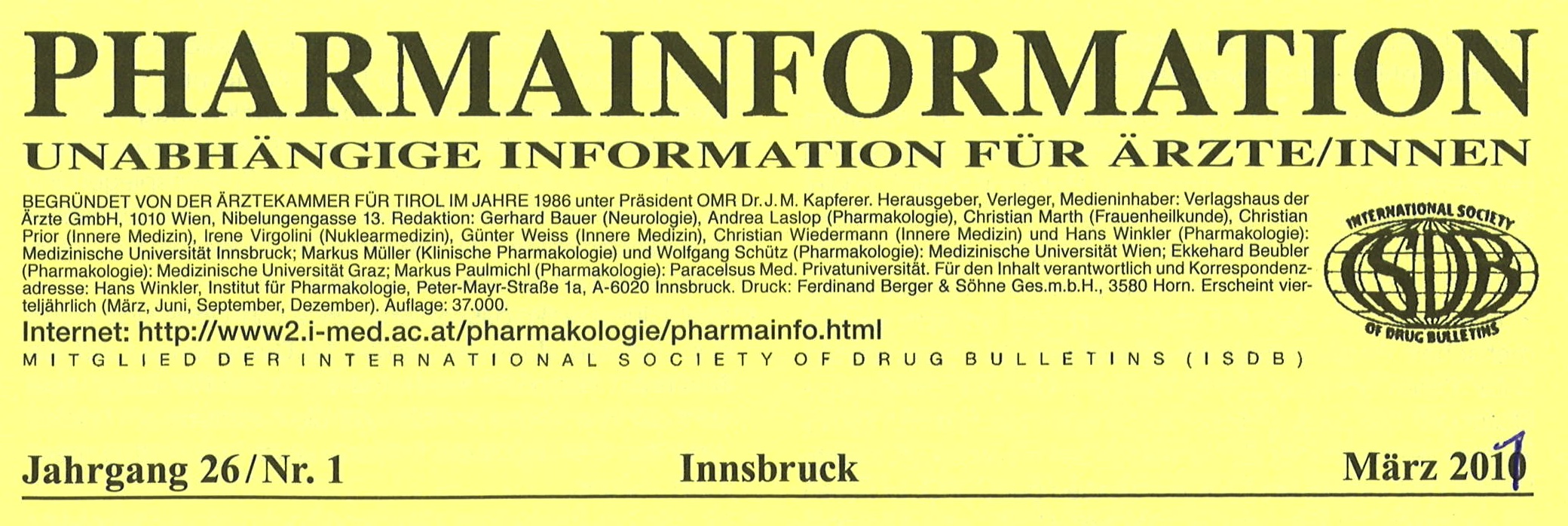
Inhalt
- Neuroprotektion
- Therapie des Schwindels
- Therapie der chronischen Hepatitis B
- Omega-3 Fettsäuren
- Modafinil
- Pharmakologie des Schnapses
Nebenwirkungen einer systemischen Langzeittherapie mit Glukokortikoiden
Glukokortikoide werden bei wichtigen Indikationen als Immunosuppressiva und in der onkologischen Chemotherapie vielfach in systemischer Langzeitmedikation verwendet. Eine verabreichte Prednisolon-Äquivalenzdosis von 7,5 bis 10 mg täglich wird als „niedrig-dosiert“ bezeichnet. In verschiedenen Studien war beobachtet worden, dass die unerwünschten Arzneimittelwirkungen (UAW) Osteoporose, Myopathie, kardiovaskuläre Erkrankungen, Infektionen und Glaukom unter diesen Dosierungen deutlich weniger oft auftreten, wenngleich für die meisten dieser UAW eine typische „Schwellen-Dosis“ nicht etabliert ist. Entscheidend für das Auftreten von UAW sind (i) die durchschnittliche Tagesdosis und (ii) die kumulative Gesamtdosis (1,2).
Die genaue Häufigkeit von UAW niedrig-dosierter Glukokortikoid Therapie wurde erst in den letzten Jahren besser untersucht. Die größte Bevölkerungsuntersuchung an mehr als 3 Millionen Personen in den USA identifizierte 6517 Patienten/innen mit einer Glukokortikoid Behandlung von >60 Tagen für eine Befragung, auf welche 2446 (38%) antworteten (3): Die drei häufigsten selbst genannten UAW waren Gewichtszunahme, Hautatrophie und Schlafstörungen (je nach Dosis und UAW bis zu 80% Häufigkeit); Katarakt wurde von 15% angegeben und Knochenbrüche von 12%; eine Frakturhäufigkeit von 10% innerhalb des Beobachtungszeitraums von 2 1/2 Jahren wurde in dieser Studie verifiziert. Das Auftreten von Frakturen zeigte eine strenge Dosis-Wirkungs-Beziehung. Bei einer durchschnittlichen Prednisolon-Äquivalenzdosis von 16 mg täglich (mittlere Dosis bei rheumatoider Arthritis 12 mg, bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung 31 mg) wurden unerwünschte Hauterscheinungen, Gewichtszunahme und Katarakt mit der Dauer der Behandlung assoziiert, wogegen Schlafstörungen und Knochenbrüche stärker mit der Höhe der täglichen Dosis im Zusammenhang standen (UAW beobachtet auch innerhalb des niedrigsten Dosis Bereichs von bis zu 7,5 mg täglich) (3). Solche Daten bestätigten, dass nicht nur die tägliche Dosis relevant ist sondern auch die Dauer der Behandlung, und dass UAW auch bei niedrig dosierter Glukokortikoid Therapie gesehen werden.
Glukokortikoid-induzierte Osteoporose
Glukokortikoide sind die häufigsten Verursacher iatrogener Osteoporose. Geschätzte 50% von Patienten/innen, die mehr als sechs Monate behandelt werden, entwickeln diese Form sekundärer Osteoporose (4,5). Nach einzelnen Studien erleiden 30 bis 50% der Betroffenen Frakturen (6). Im Vergleich zu nicht mit Glukokortikoiden behandelten Patienten/innen mit Osteoporose entwickeln sich die Knochenbrüche bei Glukokortikoid-induzierter Osteoporose bei noch relativ besseren Knochendichte Messwerten (7). Daten aus allgemeinärztlichen Praxen in England bestätigen die starke Dosis-Abhängigkeit dieser UAW. Ein um 61% erhöhtes relatives Frakturrisiko wird schon bei einer täglichen Glukokortikoid Dosis unter 7,5 mg gesehen; dieses Risiko erhöht sich um 115% bei einer Dosis von 7,5 bis 15 mg täglich; ab täglichen Glukokortikoid Dosen von 15 mg wird das weiter ansteigende Risiko dann zunehmend abhängig von der kumulativ verabreichten Gesamtdosis (8). Das unterstreicht die Notwendigkeit, Langzeittherapie mit Glukokortikoiden, wenn schon unvermeidlich, mit der niedrigst möglichen Dosis durchzuführen. Der beigemessenen großen klinischen Bedeutung von Glukokortikoid-induzierter Osteoporose stünde laut eigens darauf abzielenden Untersuchungen ein vollkommen unzureichendes ärztliches Bewusstsein hinsichtlich Diagnose und Prävention der Glukokortikoid-induzierten Osteoporose gegenüber. Weniger als 50% der Patienten/innen unter Langzeittherapie mit Glukokortikoiden erhielten laut einer Literaturanalyse aus dem Jahr 2006 Knochendichte Messungen verordnet und weniger als 25% dieser Patienten/innen erhielten eine Osteoporose Prophylaxe (9).
Infektionsrisiko
In einer vor 20 Jahren publizierten Meta-Analyse von insgesamt 71 Studien mit über 2000 Patienten/innen verdoppelten Glukokortikoide das relative Risiko für Infektionen; in der Untergruppe der Patienten/innen mit rheumatologischen Erkrankungen, das waren fünf der 71 Studien, war keine solche Risikoerhöhung gesehen worden (10). Diese letztere Beobachtung wurde in zwei späteren Langzeitstudien zu niedrig dosiertem Prednisolon (bis zu 10 mg/d für zwei Jahre) bestätigt (11,12). Im Gegensatz dazu wurde in einer amerikanischen Datenbank von 16.000 Patienten/innen in einem Zeitraum von 3,5 Jahren eine um das 1,7 fach größere Hospitalisierungsrate von Patienten/innen mit Glukokortikoid Therapie wegen Pneumonie gesehen; dieses erhöhte Risiko galt auch für niedrige Dosen bis zu 5 mg/d (Hazard Ratio 1,4; 95% Konfidenzintervall 1,1-1,6) (2). Höhere Infektionsraten unter Glukokortikoid Langzeittherapie wurden auch in neueren Beobachtungen in Studien an Patienten/innen mit rheumatoider Arthritis im Vergleich zum Methotrexat und bei Patienten/innen mit Morbus Crohn beschrieben (2,13,14). Belegt ist auch (15), dass Glukokortikoide das Risiko der Reaktivierung einer Tuberkulose bis auf das 7,5 fache erhöhen.
Akne, Hirsutismus, Haarausfall, Hautatrophie und Echymosen
Katabole Auswirkungen von Glukokortikoiden auf Keratinozyten, Fibroblasten und Gefäßwand Strukturen treten sowohl bei lokaler als auch bei systemischer Behandlung auf. In klinischen Studien wurden dermatologische UAW jedoch vielfach nur im Rahmen des iatrogenen Cushing Syndroms erfasst. Auch könnte deren systematische Erfassung vernachlässigt worden sein, weil sie oft bagatellisiert und lediglich als kosmetisches Problem angesehen wurden. Auf Basis verfügbarer Daten schließend sind Hautatrophie und kleinfleckige Blutungen bei niedrig dosierter Langzeittherapie mit Glukokortikoiden selten (16). Zu Denken geben placebo-kontrollierte Studien mit inhalativen Glukokortikoiden bei COPD, in denen im Vergleich zu Placebo Echymosen (11%) und Wundheilungsstörungen (2,5%) dosis- und altersabhängig drei- beziehungsweise fünfmal häufiger beobachtet wurden (17).
Myopathie, kardiovaskuläre Ereignisse, Pankreatitis und Wundheilungs-störungen
Die Evidenzbasis für Myopathie, kardiovaskuläres Risiko und Pankreatitis, die alle bei niedrig dosierter Therapie nicht nachweislich häufiger vorzukommen scheinen, ist schwach (2). In einer jüngeren Populationsuntersuchung an 364 Patienten/innen mit Polymyalgia rheumatica wurde keine Assoziation der Glukokortikoid Langzeittherapie mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen beschrieben (18). Zu eventuellen Wundheilungsstörungen durch niedrig dosierte Therapie liegen keine exakten Daten vor (2). Auch hier ist das Risiko gering.
Psychiatrische Störungen
Die Häufigkeit von Glukokortikoid-induzierten Psychosen wurde im „Boston Cooperative Drug Surveillance Program“ an 718 behandelten Patienten/innen systematisch untersucht. Bei 40 mg/d verabreichter Prednison-Äquivalenzdosis entwickelten 1,3% eine Psychose; die Häufigkeit stieg bei einer Dosis zwischen 40 und 80 mg/d auf bis zu 5% und lag über 18% bei noch höheren täglichen Dosen (19). Für Glukokortikoid Dosierungen <20 mg/d liegen keine Hinweise auf psychiatrische UAW vor.
Peptische Ulkusblutung
Glukokortikoid Behandlung erhöht das Risiko für peptische Ulkusblutungen und blutungsbedingte Mortalität. Eine Kohorten Studie an fast 50.000 Einwohnern Dänemarks mit über 18.000 Personenjahren an Kortisontherapie errechnete bei einer mittleren Glukokortikoid Dosis von 12 mg täglich eine Erhöhung des relativen Risikos auf 2,9 (95% CI: 2,2 bis 3,7), wenn keine weiteren Blutungs-gefährdenden Begleitmedikamente (NSAR, Aspirin, orale Antikoagulantien) gegeben wurden; das relative Risiko erhöhte sich auf 4,2 (95% CI: 3,4 bis 5,0), wenn Blutungs-gefährdende Medikamente kombiniert wurden (20). Das erhöhte Blutungsrisiko auch niedrig dosierter Langzeittherapie haben Studien an COPD Patienten/innen bestätigt, in denen sowohl die systemische als auch die inhalative Glukokortikoid Behandlung als unabhängige Risikofaktoren für peptische Ulkusblutungen identifiziert wurden (21).
Im Juli 2007 wurden erstmals evidenzbasierte EULAR („European League Against Rheumatism“) Empfehlungen zum Management einer systemischen niedrig dosierten Glukokortikoid Therapie bei rheumatologischen Erkrankungen publiziert (22). Demnach soll das Risiko-Nutzen Verhältnis mit der Einschränkung neu bewertet werden, dass eine Reihe der Empfehlungen lediglich Expertenmeinung darstellen, weil Beschreibungen und Klassifizierungen der UAW zum großen Teil aus Beobachtungsstudien und Registerdaten stammen und deswegen als nach wie vor unzureichend abgesichert eingestuft werden (23).
Bei der Glukokortikoid Gabe sollten die zirkadianen Rhythmen der zu behandelnden Erkrankung und der endogenen Glukokortikoid Sekretionberücksichtigt werden. Die CAPRA-1 Studie bestätigte diese Empfehlung in Bezug auf die Reduktion nächtlich erhöhter Zytokinspiegel und morgendlicher Gelenksteifigkeit bei abendlicher Einnahme einer Prednisolon-Retardtablette im Gegensatz zu einer nicht-retardierten Tablette morgens (24).
Weil Glukokortikoid-assoziierte UAW von Dosis und Dauer der Therapie abhängen, sollte die Dosis immer auf ein Minimum reduziert werden, wie z.B. bei Remission oder geringer Krankheitsaktivität, und die Indikation zur Fortführung der Glukokortikoid Therapie sollte regelmäßig re-evaluiert werden.
So wie bei Beginn der Glukokortikoid Therapie Risikofaktoren und Begleiterkrankungen (arterielle Hypertonie, Diabetes, peptische Ulcera, kürzlich aufgetretene Fraktur, Katarakt oder Glaukom, chronische Infektionen, Dyslipidämie und Komedikation mit NSAR) berücksichtigt werden, sind diese auch in der Langzeitbetreuung des/r Patienten/in zu überwachen. An dieser Stelle ist auch der/die Hausarzt/ärztin gefordert, da diese/r den/die Patienten/in häufiger sieht als Ärzte/innen einer spezialisierten Ambulanz. In Abhängigkeit von individuellem Risikoprofil des/r Patienten/in, Glukokortikoid Dosis und Therapiedauer sollten die Parameter Körpergewicht, Blutdruck, Auftreten peripherer Ödeme, Herzinsuffizienzzeichen, Blutfette, Blutglukose und Augendruck regelmäßig überwacht werden.
Kalzium und Vitamin-D3-Substitution führen zur Reduktion von Glukokortikoid-induziertem Knochendichteverlust und Frakturrisiko (16). Wenn bei Patienten/innen eine Therapie mit ≥7,5 mg Prednisolon pro Tag begonnen wird und diese Therapie voraussichtlich für mehr als 3 Monate angewandt werden soll, dann sollte gleichzeitig eine Substitution mit Kalzium und Vitamin D3 erfolgen. Die antiresorptive Therapie mit Bisphosphonaten zeigt sich einer Kalzium- und Vitamin-D3-Substitution sogar noch überlegen. Orale Gabe von Bisphosphonaten verbessert die Knochendichte bei Glukokortikoid-induzierter Osteoporose (25). Die intravenöse Verabreichung von 5 mg Zoledronat (Aclasta, Zometa) einmal jährlich war der täglichen Verabreichung von 5 mg Risedronat (Actonel) in der HORIZON Studie hinsichtlich der Verbesserung der Knochendichte Messwerte überlegen (26). Der Nachweis einer dadurch reduzierten Frakturhäufigkeit steht noch aus (27). Die Indikation zur Bisphosphonat Therapie für eine Reduktion des Risikos einer Glukokortikoid-induzierten Osteoporose sollte in Abhängigkeit von Risikofaktoren und dem Ergebnis einer Knochendichtemessung erfolgen. Dazu zählen erniedrigte Knochendichte, weibliches Geschlecht, höheres Alter, Postmenopause und erniedrigter „Body Mass Index“.
Patienten/innen mit Glukokortikoid- und begleitender NSAR-Therapie sollten eine adäquate gastroprotektive Medikation erhalten.
Die Entwicklung einer Nebenniereninsuffizienz hängt von Dauer, Art und Dosierung der Glukokortikoid Therapie ab. Eine Nebenniereninsuffizienz kann dosisabhängig auch bei einer Glukokortikoid Therapiedauer von weniger als 3 Wochen auftreten. Patienten/innen mit einem Risiko zur Entwicklung einer Nebenniereninsuffizienz sollen perioperativ mitGlukokortikoid substituiert werden.
Schwangere Patientinnen zeigen unter Glukokortikoid Therapie ein ähnliches Spektrum an UAW wie nichtschwangere Patientinnen. Es kommt zu keinem zusätzlichen Risiko für Mutter und Kind. Da bestimmte UAW aus diesem Spektrum jedoch mit unerwünschten Begleitwirkungen einer Schwangerschaft (z.B. Osteoporose, Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie) übereinstimmen, könnten diese durch eine Glukokortikoid Therapie verstärkt werden.
Bei Kindern vor der Pubertät hemmen Glukokortikoide das Körperwachstum über verschiedene endokrine und metabolische Mechanismen (28). Diese UAW wird sowohl bei niedrig-dosierter systemischer Gabe als auch bei der inhalativen Verabreichung gesehen (29).
Schlussfolgernd ist niedrig-dosierte Glukokortikoid Langzeittherapie bei bestimmten chronischen Entzündungserkrankungen oft Mittel der 1. Wahl. Bei längerer Dauer und in höherer Dosierung verursacht sie jedoch relevante UAW, welche zu den häufigsten iatrogenen Schädigungen bei solchen Krankheitsbildern zählen. Diese UAW sind wie oben angeführt zu bedenken, durch entsprechende Vorsichtsmassnahmen wenn möglich zu vermeiden und/oder rechtzeitig zu erkennen und behandeln.
Literatur:
(1) Curr Opin Rheumatol 20,131,2008
(2) Arthritis Rheum 54,628,2006
(3) Arthritis Rheum 55,420,2006
(4) Osteoporos Int 13,777,2002
(5) Ann Rheum Dis 61,32,2000
(6) Arthritis Rheum 56,208,2007
(7) Trends Endocrinol Metab 17,144,2006
(8) Arthritis Rheum 48,3224,2003
(9) Arch Dermatol 142,82,2006
(10) Rev Infect Dis 11,954,1989
(11) Ann Intern Med 136,1,2002
(12) Ann Rheum Dis 63,797,2004
(13) Arthritis Rheum 59,1074,2008
(14) Clin Gastroenterol Hepatol 4,621,2006
(15) Arthritis Rheum 55,19,2006
(16) Ann Rheum Dis 65,285,2006
(17) Prescrire Int 16,112,2007
(18) Arthritis Rheum 57,279,2007
(19) Ann Intern Med 125,549,1996
(20) Am J Med 111,541,2001
(21) Chest 133,1360,2008
(22) Ann Rheum Dis 66,1560,2007
(23) Ann Rheum Dis 68,1833,2009
(24) Lancet 371,205,2008
(25) Cochrane Database Syst Rev CD001347,2009
(26) Lancet 373,1253,2009
(27) Prescrire Int 18,175,2009
(28) Endocrinol Metab Clin North Am 25,699,1996
(29) Am J Respir Crit Care Med 151,1715,1995
Neuroprotektion
So häufig der Ausdruck „Neuroprotektion“ gebraucht wird, so wenig einheitlich wird er verstanden (1). Neuroprotektion (=Schutz der Neurone) kann eine primäre Verhinderung einer ZNS-Erkrankung bedeuten (z.B. Tragen eines Helms beim Sport), die Heilung derselben (z.B. antibiotische Behandlung bei ZNS-Infektion), die Verhinderung sekundärer Schäden durch symptomatische Behandlung (z.B. Verhinderung von epileptischen Anfällen und ihrer Folgen) und schließlich die Prävention der Progression der Hirnerkrankung und/oder der sekundären Schäden in einem frühen Krankheitsstadium durch sog. “disease-modifying drugs“. Neuroprotektion wurde bei cerebrovaskulären Erkrankungen versucht, aber auch bei Epilepsien, bei degenerativen ZNS-Erkrankungen wie Morbus Parkinson und Alzheimer Demenz, weiters bei Multipler Sklerose und bei Zuständen nach Schädelhirntraumata. Neben spezifischen Pharmaka wurden weitere Strategien wie Diät, neurotrophe Faktoren, Antioxidantien, Hormone, Vitamine, neurale Zelltransplantationen und Aktivierung körpereigener neuroprotektiver Mechanismen (2), z.B. durch körperliches Training (3) angewendet. Vorauszuschicken ist, dass die vermuteten Basismechanismen für Neuroprotektion unabhängig vom neurologischen Grundleiden angenommen werden. Daher wurden bei allen angeführten Erkrankungen mehr oder weniger die gleichen Substanzen untersucht.
Neuroprotektion im engeren Sinn bezeichnet die Verhinderung oder Verlangsamung krankheitsbedingter Störungen von Hirnstrukturen/-funktionen durch Medikamente. Dabei zeigt sich eine auffällige Diskrepanz zwischen tierexperimentellen und klinischen Untersuchungsergebnissen. “Everything works in animals but nothing works in people“ (1). Zahlreiche Arbeiten diskutieren die Ursachen dieser mangelhaften Übereinstimmung (z.B. 4) und münden in der Frage, ob die Übertragung tierexperimenteller Befunde überhaupt hilfreich für die Behandlung von Patienten/innen sein kann (5,6).
Getrennt für die einzelnen Erkrankungen werden im folgenden einige Punkte angeführt. Dabei ist keine vollständige experimentelle und klinische Übersicht angestrebt. Lediglich einige praktisch relevante Eckpunkte seien diskutiert. Neuroprotektion soll bei Epilepsien die zunehmende Beeinträchtigung kognitiver Funktionen verhindern. Temporallappenepilepsien stellen ein progredientes Leiden dar, bei dem es neben Anfällen zu einer Reduktion von Gedächtnisfunktionen kommt. Ursache dafür dürften neben direkten Anfallsfolgen subklinische elektrische Abnormitäten und die dadurch bedingte Umorganisation der neuronalen Vernetzung sein (7). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zwar in Tiermodellen u.a. für Levetiracetam (Keppra; 8,9) oder Topiramat (Topamax, Topilex, Topiramat Generika; 10,11) Befunde erhoben wurden, die im Sinne von Neuroprotektion gedeutet werden können, in der klinischen Anwendung aber hat kein Antiepileptikum Effekte gezeigt, die über eine Anfallsunterdrückung hinausgehen (12,13). Dennoch wirkt sich Anfallskontrolle auf den Verlauf kognitiver Fähigkeiten günstig aus. Deshalb ist es besonders wichtig, so früh wie möglich Anfallsfreiheit anzustreben und notwendige therapeutische Maßnahmen bis hin zur Epilepsiechirurgie nicht hinauszuzögern.
Antiepileptische Medikamente wurden auch bei Schlaganfällen als neuroprotektiv gedachte Maßnahmen angewandt, allerdings ohne Erfolg (u.a. 4,14). Desgleichen brachten Versuche mit über 1000 experimentell wirksamen Substanzen bei Schlaganfall Patienten/innen keine überzeugenden positiven Effekte (1), sodass die Enttäuschung in der Frage gipfelt, ob es nicht Zeit sei Neuroprotektion als Therapiemöglichkeit bei Schlaganfällen aufzugeben (6). Trotzdem sind für die Behandlung postapoplektischer Zustände mehrere Präparate (Cerebrolysin, Ambotonin, Co-Dergocrinmesilat: Ergomed, Hydergin, Naftidrofuryl: Dusodril retard, CDP-Cholin: Startonyl) noch zugelassen.
Bei Schädel-Hirn-Traumata sind die direkten Verletzungsfolgen nicht die alleinige Ursache der letztlich resultierenden funktionellen Beeinträchtigung. Sekundäre Mechanismen wie Störungen des axoplasmatischen Transportes und der Durchblutung bestimmen den Ausgang wesentlich mit. Dagegen wurden eine Reihe vermutlich neuroprotektiv wirkender Substanzen wie AMPA-Rezeptor-Antagonisten, Antiepileptika, Cox 2-Hemmer, Antioxidantien, Erythropoetin, Ionenkanalblocker ebenso wie zahlreiche andere Strategien in Tiermodellen und klinischen Studien erprobt (Zusammenfassung bei 15). Wiederum gelang die Übertragung positiver Ergebnisse im Tierversuch auf die Klinik nicht, wenngleich eine Reihe von Studien noch im Gange sind (15). Derzeit aber steht keine Substanz mit einer Evidenz-basierten, klinisch fassbaren neuroprotektiven Wirkung zur Verfügung. Trotzdem sind in Österreich nach wie vor Arzneimittel in dieser Indikation registriert (Cerebrolysin, Ambotonin, CDP-Cholin: Startonyl). Der Kalzium-Antagonist Nimodipin (Nimotop) wurde auch als Neuroprotektivum untersucht und diesbezüglich als unwirksam gefunden. Die Indikation als Prophylaktikum für Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung ist hingegen belegt (16). Neben Medikamenten wurden auch zahlreiche andere Strategien zur Neuroprotektion nach Schädelhirntrauma untersucht. Einzig die Hypothermie-Behandlung (34 – 35° Celsius) hat sich als wirksam erwiesen (15a).
Die Parkinson’sche Erkrankung ist ein paradigmatisches Beispiel einer umschrieben beginnenden neurodegenerativen Erkrankung. Für die symptomatische Behandlung stehen eine Reihe sehr effektiver Medikamente zur Verfügung (siehe Pharmainfo XXIV/1/2009). Wirken diese Therapien aber auch auf das Fortschreiten der Erkrankung im Sinne eines “disease-modifying“, neuroprotektiven Effektes? Kritische Analysen kamen diesbezüglich zu einer negativen Bewertung der zugelassenen Parkinsonmittel (17). Für Rasagilin wurden Daten erhoben, die bei einer Dosis von 1mg/Tag für einen neuroprotektiven Effekt sprachen (18). Merkwürdigerweise konnte dieser Effekt mit der höheren Dosis von 2mg/Tag nicht reproduziert werden (18). Insgesamt kann daher auch für Rasagilin (Azilect) eine neuroprotektive Wirkung nicht belegt werden (19). Die beste Strategie hinsichtlich des Fortschreitens der Erkrankung bleibt eine ohne Verzögerung eingesetzte symptomatische Behandlung (20).
Bei Alzheimer Demenz, wie kürzlich in der Pharmainfo (XXV/2/2010) diskutiert, konnte bisher für kein Medikament eine Verzögerung des Krankheitsverlaufs und damit eine neuroprotektive Wirkung überzeugend nachgewiesen werden.
Der Begriff Neuroprotektion dokumentiert den Wunsch, neben einer symptomatischen Therapie auch Mittel zur Verfügung zu haben, die den progressiven Neuronenverlust bei ZNS-Erkrankungen per se günstig beeinflussen. In Tierversuchen gelingt der Nachweis eines neuroprotektiven Effektes in zahlreichen Modellen verschiedener Erkrankungen, in der Klinik ist der Nachweis desselben aber schwierig und bislang nicht gelungen. Trotz dieser enttäuschenden Feststellung kann gesagt werden, dass eine erfolgreiche symptomatische Therapie sich auch auf den weiteren Krankheitsverlauf günstig auswirkt und deshalb so früh und so effektiv als möglich durchgeführt werden muss.
Literatur:
(1) Ann Neurol 59,467,2006
(2) Progr Neurobiol 84,363,2008
(3) JNNP 80 942,2009
(4) Ann Neurol 53,693,2003
(5) BMJ 328,514,2004
(6) Stroke 39,1659,2008
(7) Epilepsy Research 50,141,2002
(8) Epileptic Disorders 5(suppl 1),S9,2003
(9) J Pharmacol Exp Therap 284,474,1998
(10) Epilepsy Research 54,63,2003
(11) Epilepsia 45,1478,2004
(12) Neurology 59(suppl 5),S36,2002
(13) Epilepsia 42,515,2001
(14) Brain Research Reviews 42,187,2003
(15) Drug Discovery Today 13,1082,2008
(15a) Lancet 371,1955,2008
(16) Cochrane Database Syst Rev 25,CD 000277,2005
(17) Ann Neurol 64(suppl),S101,2008
(18) NEJM 361,1268,2009
(19) Neurology 74,1143,2010
(20) Neurology 72(suppl 2),S44,2009
Medikamente zur Therapie des Schwindels
Reiner Fischer-Colbrie (Pharmakologisches Institut) und Arne W. Scholtz (HNO, Medizin. Univ. Innsbruck)
Schwindel (Vertigo) wird multifaktoriell von vestibulären und somatosensorischen Störungen, Sehstörungen, cardialen und zerebralen Erkrankungen, Reise(See)krankheit, Alkohol und auch diversen Pharmaka ausgelöst. Schwindel ist ein häufiges Symptom in ärztlichen Praxen mit erhöhter Prävalenz im Alter – mit 32% bei 70-Jährigen bzw. bis zu 50% bei über 88-Jährigen (1).
Die Pharmakotherapie des Schwindels richtet sich primär nach der jeweiligen Diagnose. Häufige Ursachen für akuten und wiederkehrenden Schwindel sind der gutartige Lagerungsschwindel (BPPV, benign paroxysmal positional vertigo) und Neuritis vestibularis (Neuropathia vestibularis), die jeweils ca. 40% der Diagnosen beim Allgemeinpraktiker bzw. 10-20% in Schwindelambulanzen ausmachen (2, 3). In Spezialambulanzen folgen im weiteren mit absteigender Häufigkeit phobischer Schwankschwindel (16%), zentral-vestibulärer Schwindel (12%), vestibuläre Migräne (11%), Morbus Menière (9%), bilaterale Vestibulopathie (6%), Vestibularisparoxysmie (4%) und psychogener Schwindel (3%). Pharmakogener Schwindel wird hauptsächlich von Antihypertensiva (ACE-Hemmer, Sartane, ß1 Blocker, Ca2+-Kanalblocker), α1 Blockern, H1 Blockern, H2 Blockern, NSAR: Nicht Steroidale Anti-Rheumatika, Östrogenen und SSRIs: Selektive Serotonin Re-uptake Inhibitor verursacht.
BPPV wird primär physikalisch mit Lagerungsmanövern behandelt (4). Bei Neuritis vestibularis wird häufig eine Kombination aus sensomotorischem Training und Methylprednisolon angewandt (5). Für Vestibularisparoxysmien haben sich Carbamazepin (Deleptin, Neurotop, Tegretol: 6) oder Gabapentin (Gabapentin Generika, Gabatal, Neurontin: 7) in niedriger Dosierung als wirksam gezeigt.
Im Folgenden beschäftigen wir uns nicht mit der Therapie dieser einzelnen vestibulären Erkrankungen, sondern generell mit der Therapie des Symptoms Schwindel. Trotz enormer medizinischer Fortschritte in den letzten Jahrzehnten ist die Pharmakotherapie des Schwindels wenig befriedigend. In Österreich sind für die Indikation Schwindel die H1 Antihistaminika Dimenhydrinat (auch in Kombination mit Cinnarizin) und Cyclizin, das Histamin Analogon Betahistin und Ingwerwurzel zugelassen.
Antihistaminika sind die am längsten und häufigsten verwendeten Präparate bei akuter Schwindelsymptomatik. Sie hemmen als inverse Agonisten die histaminerge Neurotransmission über den konstitutiv aktiven H1 Rezeptor. Die antivertiginöse Wirkung kommt wahrscheinlich durch Blockade des histaminergen Signals vom N. vestibularis zum medullären Brechzentrum zustande (8). Verwendet werden ZNS-gängige Antihistaminika der ersten Generation wie Dimenhydrinat (Vertirosan, Vertirosan B6, Emedyl, Neoemedyl), das das Antihistaminikum Diphenhydramin als Chlorotheophyllin Salz enthält, sowie Cyclizin (Echnatol, Echnatol B6). ZNS-gängige Antihistaminika besitzen eine ausgeprägte zentral dämpfende und sedierende sowie eine anticholinerge Komponente. Sie sind daher primär bei akuten schweren Schwindelformen mit Übelkeit und Erbrechen als Kurzzeittherapie indiziert, um endogene vestibuläre Kompensationsmechanismen möglichst wenig zu behindern. Die zusätzliche anticholinerge Komponente bewirkt Mundtrockenheit, Harnretention und kann Glaukomanfälle auslösen. Sie trägt möglicherweise auch zur Wirkung bei. Die wichtigste Nebenwirkung der Antihistaminika ist eine dosis-abhängige Sedierung, bedingt durch eine Aktivitätsverminderung von am Wachzustand beteiligten Histamin Neuronen, die auch die Gedächtnisleistung und das Reaktionsvermögen (cave Autofahren) beeinflusst. Obwohl Dimenhydrinat bereits sehr lange gegen Schwindel verwendet wird, gibt es nur wenige Studien, die die Wirksamkeit gegenüber Placebo belegen (9,10). Etwas besser dokumentiert ist die Wirksamkeit der Kombination von Dimenhydrinat mit Cinnarizin (Arlevert: 10-12), wobei letzteres auch als Monosubstanz (Pericephal) einen Effekt gegen Vertigo besitzt (13). Die Kombination war auch wirksamer als Betahistin (14-16), dessen Wirkung (siehe unten) umstritten ist. In Fixkombination ergeben sich für Dimenhydrinat/Cinnarizin bezüglich der Wirkung additive Effekte, sodass die Dosis im Vergleich zu Einzelkomponenten verringert werden kann und als Folge das Risiko für Nebenwirkungen reduziert ist. Dies kommt insbesondere bei den zentral dämpfenden Effekten von Dimenhydrinat sowie beim Auftreten von extrapyramidalen Störungen durch Cinnarizin (siehe Pharmainfo VII/2/1992), die vor allem bei längerer Therapie mit höheren Dosen auftraten (17), zum Tragen.
Betahistin (Bestin, Betahistin Generika, Betaserc) ist ein Histamin Analogon, das als inverser Agonist am präsynaptischen H3 Rezeptor und schwacher Agonist am H1 Rezeptor wirkt (18). Die Wirkung am H3 Autorezeptor führt insgesamt zu einer vermehrten neuronalen Histamin Freisetzung (8), die aber einer starken Toleranz unterliegt. Betahistin ist in mehreren europäischen Staaten, nicht aber in den USA, zur Behandlung des Ménière Symptomenkomplex (Schwindel, Tinnitus, Hörverlust) zugelassen. Als Nebenwirkungen sind Kopfschmerz und Nausea beschrieben. Der genaue Wirkmechanismus ist unbekannt. Paradoxerweise sind also sowohl H1 Antihistaminika (Dimenhydrinat) als auch Histamin Analoga (Betahistin) als Antivertiginosa zugelassen. Eine gleichartige Wirkung sowohl von einem Agonisten als auch Antagonisten erscheint unwahrscheinlich. Tatsächlich ist die Wirksamkeit von Betahistin zur Reduktion von Tinnitus und Schwindelattacken bei Ménièrescher Erkrankung umstritten. Ein Cochrane Review kommt zum Schluss, dass die klinischen Studien (7 Studien mit nur 243 Patienten/innen) großteils nicht aussagekräftig sind (19). Der Hörverlust wurde überhaupt in keiner Studie gebessert (19). Auch die FDA votierte 1999 mangels Wirkungsnachweis gegen eine erneute Zulassung von Betahistin für die USA. Für Schwindel außerhalb der Ménièreschen Erkrankung findet eine Metaanalyse (7 Studien mit 367 Patienten/innen) einen positiven Effekt (20). Offensichtlich ist die Bewertung von Betahistin unklar, bis zum Vorliegen von Placebo-kontrollierten Studien mit einer höheren Anzahl an Patienten/innen fehlt daher ein eindeutiger Nachweis der Wirksamkeit.
Zur Vorbeugung von Schwindel als Symptom bei Reisekrankheit ist gemahlene Ingwerwurzel (Ingwer Kapseln Arkocaps, Zintona) zugelassen. Wir haben in der Pharmainfo VIII/2/1993 berichtet, dass dieses Präparat keine signifikante Antikinetoseaktivität besitzt. Auch eine nachfolgende Metaanalyse kam zum Schluss, dass die vorliegenden Studien nicht ausreichend sind, um eine positive Wirkung von Ingwer auf Nausea und Erbrechen zu belegen (21). Zur Indikation Schwindel sind für Ingwer keine Daten in Placebo-kontrollierten Studien zu finden.
Zusammenfassung: Die Pharmakotherapie des akuten Schwindels ist pharmakologisch unbefriedigend. Als sinnvolle Präparate können kurzfristig bei schwerer Schwindelsymptomatik ZNS-gängige Antihistaminika - auch in Kombination mit Cinnarizin - verwendet werden. Bei pharmakogenem Schwindel vor allem bei der älteren Bevölkerung ist nicht die Gabe eines Antivertiginosums Mittel der Wahl, sondern die Umstellung auf andere Präparate, Dosisanpassung bzw. Optimierung der Pharmakotherapie.
Literatur:
(1) J Vestib Res 14,47,2004
(2) BMJ 339,749,2009
(3) DAZ 150,1682,2010
(4) NEJM 341,1590,1999
(5) NEJM 351,354,2004
(6) Lancet 343,798,1994
(7) J Neurol Sci 281,99,2009
(8) NEJM 351,2203,2004
(9) Acta Otolaryngol 99,588.1985
(10) Clin Drug Invest 18,355,1999
(11) Clin Ther 29,84,2007
(12) Clin Ther 26,866,2004
(13) Otol Neurootol 23,357,2002
(14) Clin Drug Invest 25,377,2005
(15) Int Tinnitus J 14,57,2008
(16) Clin Drug Invest 28,89,2008
(17) Movement Disord 12,107,1997
(18) J Pharmacol Exp Ther 334,945,2010
(19) Cochrane database of systematic reviews (2001 & 2009 Issue 1)
(20) Acta Otorhinolaryngol 26,208,2006
(21) Brit J Anaesthesiol 84,367,2000
Therapie der chronischen Hepatitis B
Markus Peck-Radosavljevic, Gastroenterologie, Innere Medizin III, AKH, Wien
Die chronische Hepatitis B hat das Feld der Hepatologie in den letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt. Während seit den ´60er Jahren die Entwicklung der Diagnostik und Prophylaxe im Vordergrund standen, konnten in den letzten 15 Jahren dramatische Fortschritte im Bereich der Therapie der chronischen Hepatitis B verzeichnet werden. Die Herausforderung heute liegt vor allem in der weltweit flächendeckenden Prophylaxe durch Schutzimpfung sowie der zeitgerechten Diagnosestellung, damit durch die passende Therapie Spätkomplikationen möglichst effektiv verhindert werden können.
Epidemiologie und Diagnostik der chronischen Hepatitis B
Ca. 88% der Weltbevölkerung leben in Gebieten mit mittlerer bis hoher Prävalenz des Hepatitis B-Virus (HBV), Schätzungen zufolge sind weltweit ca. 350-400 Mio. Menschen chronische Virusträger. In Österreich, einem Niedrigendemiegebiet, liegt die Prävalenz der chronischen Hepatitis B bei 0,3-2,5% der Bevölkerung. Relevante Marker einer chronischen Hepatits B (CHB) sind der Nachweis von HBV-DNA (direkter Virusnachweis), Veränderungen der Leberfunktionsparameter (Aminotransferasen, GPT), serologische Marker der Hepatitis B (HBeAg, HBsAg) sowie der histologische Nachweis von Entzündung bzw. Fibrose/Zirrhose (1).
Bei fast jeder chronischen Hepatitis B ist das HBs Antigen (HBsAg) nachweisbar. Das HBeAg im Gegensatz wird nicht immer produziert, sondern nur bei der HBeAg+ Form. Bei der Hepatitis B mit “Precore-Mutante“ gibt es keine Produktion von HBeAg (HBeAg- CHB). Die Indikation zur Behandlung besteht bei beiden Erkrankungen in Abhängigkeit von der entzündlichen Aktivität, der Höhe der Virusreplikation und dem bereits vorliegenden Leberschaden.
Aktuelle Therapiekonzepte
Für die Behandlung der CHB stehen zwei unterschiedliche therapeutische Ansätze zur Verfügung:
(i) Durch immunstimulierende Therapeutika wie Interferon-α (IFN-α) soll eine verminderte Virusvermehrung und im Idealfall eine immunologische Kontrolle der Erkrankung mit anhaltendem Ansprechen (“sustained response“ meist verbunden mit Serokonversion) ohne weiteren Bedarf an antiviralen Substanzen durch eine zeitlich limitierte Therapie (1 Jahr) erreicht werden (2).
(ii) Durch direkt antiviral wirkende Substanzen wie Nukleosid- und Nukleotidanaloga (Blockade der HBV-DNA-Polymerase) andererseits soll eine möglichst effektive Virussuppression bei kontinuierlich weiterzuführender antiviraler Therapie erzielt werden. Der Idealfall einer HBsAg zu anti-HBs Serokonversion tritt hier nur selten ein (3).
In beiden Fällen bleibt HBV-DNA zumindest in episomaler Form in den Leberzellen vermutlich lebenslang erhalten, auch wenn es keine aktive Virusreplikation gibt. Dies ist deshalb von Bedeutung, da es auch nach langer Zeit entweder durch massive immunsuppressive Therapie (TNF-Antagonisten, Rituximab, etc.) oder durch zytostatische Chemotherapie zum Verlust der immunologischen Kontrolle und zur Reaktivierung des Hepatitis B Virus bis hin zur fulminanten Hepatitis kommen kann.
Kriterien für die Therapieentscheidung
Die Therapie der CHB sollte eine hohe Wirksamkeit im Sinne einer potenten Virussuppression mit dem Ziel eines negativen HBV-DNA-Nachweises nach 6 Monaten, Elimination von HBeAg bei Positivität sowie im Idealfall die Elimination von HBsAg aufweisen. Weitere entscheidende Anforderungen sind ein günstiges Resistenzprofil sowohl bei therapienaiven als auch bei vorbehandelten Patienten/innen und eine gute Verträglichkeit.
Wahl des Therapeutikums
Interferon-α
Die Therapie mit IFN-α (Intron A, Roferon-A) verbessert bei HBeAg+ CHB-Patienten/innen sowohl mit als auch ohne Zirrhose das Überleben (4). IFN-α wird dreimal pro Woche subkutan appliziert, während das pegylierte Interferon, pegIFN-α2a (Pegasys) nur einmal pro Woche verabreicht werden muss. Im Vergleich zu Lamivudin (Zeffix) wird innerhalb eines Behandlungsjahres eine deutlich höhere HBeAg-Serokonversionsrate erzielt (32% vs. 19% in einer direkten randomisierten prospektiven Vergleichsstudie: 2), was mit einem deutlichen Abfall der HB-Viruslast einhergeht und das primäre Therapieziel darstellt. Ausserdem kommt es unter IFN-a innerhalb eines Jahres nach erreichter HBeAg Serokonversion bei deutlich weniger Patienten/innen zu einem Relaps, im Gegenteil, die Serokonversionsraten steigen nach beendeter IFN-Therapie weiter an, während dies für Lamivudin nicht der Fall ist. Auch die HBsAg Serokonversionsrate lag mit pegIFN-α2a nach 1 Jahr Therapie bei 4% (im Vergleich 0% bei Lamivudin). Das Ansprechen auf IFN-α ist vom HBV Genotyp abhängig, wobei von den bei uns vorkommenden Genotypen der Genotyp A wesentlich besser auf IFN-α anspricht als der Genotyp D (welcher bei den Immigranten/innen aus dem Mittelmeerraum vorherrscht; 5). Vorteile von IFN-α (und gleichfalls pegIFN-α2a) sind eine vordefinierte Therapiedauer, ein potentiell lang anhaltendes Therapieansprechen nach Therapieende, eine vergleichsweise hohe Eliminationsrate von HBeAg und HBsAg sowie das Fehlen von Resistenzbildung; allerdings ist die Injektionstherapie mit beträchtlichen Nebenwirkungen verbunden und bei Patienten/innen mit dekompensierter Lebererkrankung kontraindiziert.
Die wichtigsten Nebenwirkungen der Therapie sind Fieber, Gelenks- und Muskelschmerzen, Grippegefühl, Inappetenz und Depression.
Zusammenfassend besteht eine optimale Indikation zur pegIFN-Therapie bei kompensierter Lebererkrankung, erhöhten Transaminasen, niedriger Viruslast und Genotyp A-Infektion.
Nukleosid- und Nukleotidanaloga
Neben IFN-a und pegIFN-a2a sind für die Behandlung der CHB mehrere Nukleos(t)idanaloga zugelassen, die bei dauerhafter Einnahme eine potente Suppression der Virusreplikation und ebenfalls ein deutlich verbessertes Patienten/innenüberleben bieten (6). Vorteile dieser Substanzgruppe sind die sehr gute Verträglichkeit, die Anwendbarkeit unabhängig vom Genotyp und vom Bestehen einer Zirrhose und der orale Applikationsmodus. Ihre Langzeit-Wirkung kann je nach Präparat in unterschiedlichem Ausmaß durch das Auftreten von Resistenzen limitiert sein.Die potentesten Virustatika sind die Nukleosidanaloga Entecavir (Baraclude) und Telbivudin (Sebivo) sowie das Nukleotidanalogon Tenofovir (Viread). Diese Substanzen stellen entsprechend dem ÖGGH-Konsensus 2009 die orale Erstlinientherapie bei chronischer Hepatitis B dar, bei Neueinstellung eines/r Patienten/in auf eine orale Therapie sollten diese Medikamente zum Einsatz kommen. Lamivudin (Zeffix) wird wegen hoher Resistenzentwicklung und Adefovir (Hepsera) wegen schlechter antiviraler Potenz nach den aktuellen Empfehlungen heute nicht mehr zur Neueinstellung von Patienten/innen mit chronischer Hepatitis B verwendet. Einschränkend darf angemerkt werden, dass lediglich für Telbivudin und Tenofovir in Österreich die Kosten von der Kasse übernommen werden, für Entecavir ist dies nicht der Fall.
Allen 3 Substanzen gemeinsam ist eine hervorragende antivirale Potenz, wobei Entecavir und Tenofovir zudem eine extrem niedrige Resistenzentwicklung bei nicht-vorbehandelten Patienten/innen aufweisen, die für Telbivudin etwas höher liegt.
Bei auf Lamivudin-resistenten Patienten/innen ist Telbivudin zumeist wirkungslos und die Gefahr einer Resistenzentwicklung mit Entecavir deutlich erhöht, sodass bei diesen Patienten/innen Tenofovir die Therapie der Wahl darstellt. Während alle 3 Substanzen hinsichtlich der HBeAg-Serokonversion ähnliche Wirksamkeit aufweisen und sich nicht von Lamivudin unterscheiden (siehe oben), dürfte Tenofovir hinsichtlich des HBsAg-Verlusts Vorteile gegenüber den anderen oralen Substanzen aufweisen und im Bereich von pegIFN-a2a liegen (3% nach einem Jahr Therapie, 6% nach 2 Jahren Therapie; 7). Rezente Daten zeigen jedoch, dass die HBeAg-Serokonversion unter Nucleos(t)id-Therapie nicht einmal unter Therapie anhaltend sein muss und dass es nach Absetzen der Therapie in der überwiegenden Mehrzahl der Patienten/innen zu einer Reaktivierung des Virus kommt (8).
Adefovir spielt heute wegen der geringen antiviralen Potenz kaum mehr eine Rolle. Der Einsatz von Lamivudin in der Erstlinientherapie sollte wegen der inakzeptabel hohen Resistenzrate von 70% nach 4 Jahren höchstens noch in Spezialindikationen erfolgen, in denen bisher wenig Daten für die neueren Substanzen vorliegen (akute Hepatitis B, Schwangerschaft, Prävention einer Reaktivierung durch Chemotherapie, etc.).
Prävention der HBV-Reaktivierung bei Immunsuppression oder Chemotherapie
Da das HB-Virus lebenslang in den Hepatozyten persistieren kann und durch immun-mediierte Mechanismen kontrolliert wird, kann eine starke Immunsuppression wie z.B. durch Lymphozyten-depletierende Therapien (Rituximab: Mabthera), TNF-Antikörper (Infliximab: Remicade, Adalimumab: Humira etc.) oder durch zytostatische Chemotherapie zur Reaktivierung des HBV führen. Besonders gefährlich sind in dieser Hinsicht myeloablative Therapien mit der Maximalform der Knochenmarktransplantation (KMT). Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, vor Einleitung dieser Therapien den HBV-Status der Patienten/innen zu erheben.
Dabei sollten alle HBsAg+ Patienten/innen eine Nucleos(t)id-Prophylaxe schon vor Beginn der immunsuppressiven/zytostatischen Therapie erhalten, welche je nach Viruslast 6 oder 12 Monate lang nach Ende der Therapie weitergeführt werden muss. HBsAg- aber Hepatitis B c-Antikörper+ (HBcAk+) Patienten/innen benötigen (außer bei KMT) keine Prophylaxe, sollten aber alle 3 Monate unter Therapie auf das Auftreten von HBsAg oder HBV-DNA überwacht werden.
Bei KMT müssen auch alle HBcAk+ Patienten/innen (auch die mit durchgemachter und abgeheilter Hepatitis B) eine Nucleos(t)id-Prophylaxe erhalten.
Im Gegensatz zur Therapie der chronischen Hepatitis B kann zur Prophylaxe auch Lamivudin eingesetzt werden, allerdings sollte, wie bei der Therapie der chronischen Hepatitis B, wegen der Gefahr der Resistenzentwicklung auch bei der Prophylaxe alle 3 Monate eine HBV-DNA-Quantifizierung durchgeführt werden.
Hepatitis D Superinfektion
Die chronische Hepatitis D stellt immer eine Superinfektion im Rahmen einer chronischen Hepatitis B dar, da das Delta-Virus inkomplett ist und zur Replikation das HBs-Protein von HBV benötigt. Der Nachweis einer Delta-Superinfektion erfolgt einerseits durch Bestimmung des HDV-Antikörpers im Serum, andererseits durch Nachweis der HDV-RNA im Serum.
Therapeutisch unterscheidet sich die Hepatitis D insofern von der chronischen HBV-Infektion, als eine Therapie mit Nukleos(t)idanaloga fast nie zu einem Therapieerfolg führt. Dieser kann ausschließlich durch eine Therapie mit Interferon-a erreicht werden. Allerdings lag die virologische Response in der bisher einzigen publizierten Studie mit pegIFN-a2b nach 72 Wochen Therapie bei 28%, eine virologische Heilung 6 Monate nach Therapieende konnte bei nur 21% der Patienten/innen beobachtet werden (9).
Die Diagnosestellung einer Delta-Superinfektion ist wichtig für die Therapieentscheidung bei chronischer Hepatitis B, die deshalb bei jeder chronischen HBV-Infektion zumindest einmal durchgeführt werden sollte – vor allem dann, wenn die Patienten/innen aus Südeuropa, Osteuropa oder den Staaten der früheren Sowjetunion stammen, wo eine Delta-Superinfektion bei ca. 30% der Patienten/innen vorliegen dürfte.
Zusammenfassung
In den letzten Jahren konnte eine deutliche Verbesserung in der Diagnostik, in der Genotyp- und patienten/innengerechten Auswahl des therapeutischen Regimes sowie in der Prävention von Komplikationen der chronischen Hepatitis B erreicht werden. Heutzutage sind alle Patienten/innen mit chronischer Hepatitis B gut zu behandeln, wenn die Diagnose rechtzeitig gestellt wird, bevor die Komplikationen des Endstadiums der Zirrhose mit Dekompensation oder hepatozellulärem Karzinom auftreten. Die größten Verbesserungen in der nächsten Zeit aus gesundheitspolitischer Sicht sind durch die konsequente Detektion von chronisch-infizierten Patienten/innen mit konsekutiver Therapie zu erzielen. Im Einzelfall schwer therapierbarer Patienten/innen, v. a. mit Delta-Superinfektion, werden hoffentlich neue Substanzen in den nächsten Jahren ebenfalls einen Fortschritt bringen.
Literatur:
(1) Wien Klin W 122,280,2010
(2) NEJM 352,2682,2005
(3) Hepatol 45,1056,2007
(4) NEJM 334,1422,1996
(5) Lancet 365,123,2005
(6) NEJM 351,1521,2004
(7) NEJM 359,2442,2008
(8) Gastroenterol 139,491,2010
(9) Hepatol 44,713,2006
Update: Zum Nutzen von Omega-3 Fettsäuren
In der Pharmainfo XIX/2/2004 stellten wir, so wie viele andere fest, dass aufgrund epidemiologischer Studien Fischkonsum zur Sekundärprävention kardiovaskulärer Ereignisse zu empfehlen ist. Fischfett enthält mehrfach ungesättigte Omega-3 Fettsäuren, vor allem Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. Diese werden auch in Fischölkapseln (Omacor)angeboten. Für die Zufuhr dieser Kapseln sahen wir aufgrund der großen GISSI Prevenzione Studie an 11.323 Patienten/innen eine Indikation zur Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt. In dieser 4jährigen Studie kam es nach Verabreichung von 1,0 g Omega Fettsäure schon nach 4 Monaten zu einer Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse um 15%, wobei dies vor allem auf eine Abnahme des plötzlichen Herztodes um 45% zurückzuführen war (1,2). In dieser Studie erhielten aber die Patienten/innen keine optimale Therapie für die Reinfarktperiode (nur 4,7% am Beginn und 45,5% am Ende der Studie nahmen Statine ein, 40% bekamen ACE-Hemmer und Betablocker). Wir stellten daher fest, dass eine zusätzliche Wirksamkeit von Fischölkapseln bei optimaler Therapie noch nicht belegt ist. Eine weitere große Studie (GISSI-HF: 3) behandelte Patienten/innen mit Herzinsuffizienz mit 1 g Omega Fettsäure. Obwohl 41,8% dieser Patienten/innen schon einen Herzinfarkt hatten, erhielten nur 22,3% ein Statin, also auch hier war die Behandlung nach heutigem Standard suboptimal. Die kardiovaskuläre Mortalität nahm im Laufe von 4 Jahren um 10% ab, wobei auch hier der plötzliche Herztod als wesentliche Komponente zu sehen war.
In einer großen japanischen Studie (JELIS: 4) an Patienten/innen (n = 18.645) mit einem hohen Cholesterinspiegel, aber nur zu einem geringen Teil mit vorherigem Herzinfarkt (nur 5%), oder mit Angina pectoris (16%), führte 1,8 g Fischöl zu einer Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse um 19%, vor allem durch Abnahme der Herzinfarkte, aber ohne Änderung bei plötzlichem Herztod. Signifikant waren diese Effekte nur bei der kleinen Subgruppe von Patienten/innen mit vorhergehender kardiovaskulärer Erkrankung, aber nicht bei Patienten/innen, bei denen diese Therapie eine primäre Prävention darstellte. Alle Patienten/innen hatten ein Statin erhalten. Es ist schwer verständlich, wie eine Zufuhr von Omega Fettsäuren in Japan einen Effekt haben soll, wenn man bedenkt, dass aufgrund der fischreichen Ernährung in diesem Land der Plasma EPA (Eicosapentaensäure) Spiegel bei diesen Patienten/innen am Anfang 2,9 mol % betrug, während in den USA dieser nur 0,3 mol % sein soll. Leider wurde in der Studie nicht gemessen, ob es zu einem Anstieg kam. In einer amerikanischen Studie stieg nach der hohen Dosis von 4 g Omega 3-Fettsäure der Blutspiegel um das 2,5fache, sodass auch diese erhöhten Werte weit unter den japanischen Basiswerten liegen (5). Es erscheint daher zweifelhaft, ob Studien dieser Art an japanischen Patienten/innen für europäische Patienten/innen relevant sind.
Diese Daten waren also offensichtlich unzureichend und es war zu hoffen, dass in den nachfolgenden Jahren zwei Fragen geklärt werden:
1. Ein plötzlicher Herztod wird meist durch Arrhythmie bedingt. Liegen inzwischen Studien vor, die eine antiarrhythmische Wirkung von Fischöl belegen? Wir können dies verkürzt darstellen, da die Mehrheit der Daten belegt, dass dies nicht der Fall ist (siehe Metaanalyse und Reviews: 6-9). Untersucht wurde diese Frage an Patienten/innen mit implantierten Defibrillatoren für die Frage ventrikulärer Arrhythmien und an Patienten/innen mit spontan auftretendem Vorhofflimmern (5).
2. Ist es heute belegt, dass Patienten/innen nach einem Herzinfarkt unter optimaler Behandlung einen zusätzlichen Nutzen durch Fischöl Gabe haben? In den letzten Jahren haben mehrere Metaanalysen und Reviews festgestellt, dass Omega Fettsäuren kardiovaskuläre Ereignisse reduzieren (8-11). In einer Metaanalyse (11) wurden z.B. ca. 39.000 Patienten/innen und 11 Studien erfasst. Allerdings waren 37.000 Patienten/innen den drei großen Studien (zweimal GISSI und JELIS) zuzuordnen und die erhobenen positiven Effekte wurden entscheidend von diesen Studien beeinflusst (11). Wir haben bereits die Heterogenität dieser Studien diskutiert: GISSI Prevenzione (1,2: Postinfarktpatienten/innen ohne optimale Post-Infarkttherapie, Senkung des plötzlichen Herztodes), GISSI HF (3: Patienten/innen mit Herzinsuffizienz), JELIS (4: Großteil der Patienten/innen ohne CV-Erkrankung, signifikante Senkung von Herzinfarkten nur bei Subgruppe, keine Reduktion bei plötzlichem Herztod, japanische Patienten/innen mit sehr hoher Basalrate von Fettsäurezufuhr). Ob daher Metaanalysen dieser Art eine klinische Relevanz haben, sei dahingestellt.
Auf jeden Fall können sie nicht unsere obige Frage beantworten. In der letzten Zeit sind aber drei für diese Frage relevante Studien publiziert worden.
Die Alpha Omega Studie (12) wurde an 4.835 Herzinfarktpatienten/innen durchgeführt, die eine optimale Nachbehandlung (ACE-Hemmer, Betablocker, Statine und Aggregationshemmer für 85,3 bis 98,2% der Patienten/innen) hatten. Sie erhielten 376 mg Omega-3 Fettsäure. Nach 14 Monaten ergab sich keine Änderung der kardiovaskulären Ereignisse (14,0 versus 13,8%: tödliche und nicht tödliche Herzinfarkte und kardiale Interventionen). Kritisch ist anzumerken, dass eine relativ niedrige Fettsäuredosis verwendet wurde.
In einer in Deutschland durchgeführten Studie (Omega Studie: 13) an 3.851 Postinfarkt-Patienten/innen wurde eine höhere Dosis von 1 g Fettsäure verwendet. Auch hier erhielten die Patienten/innen eine optimale Nachinfarktbehandlung. Nach einem Jahr war kein Effekt der Fettsäurezufuhr auf den plötzlichen Herztod, die Gesamtmortalität und cerebro-kardiovaskuläre Ereignisse zu sehen. Kritisch anzumerken ist, dass in dieser Studie aufgrund der optimalen Postinfarkttherapie kardiovaskuläre Ereignisse selten waren und daher trotz der relativ hohen Zahl von Patienten/innen das negative Resultat statistisch nicht optimal abgesichert ist. Aber auch eine weitere ähnliche Studie (13a: 633 Patienten/innen in Verum Gruppe) konnte nach 600 mg Omega-3 Fettsäuren nach 5 Jahren keinen positiven Effekt sehen. Auf jeden Fall können wir zusammenfassend feststellen: Derzeit sind keine ausreichenden Daten vorhanden die sicherstellen, dass in der Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt bei Patienten/innen mit korrekter Nachbehandlung die Gabe von Omega-3 Fettsäuren einen positiven Effekt entfaltet.
Die Daten sprechen eher dafür, dass eine optimale Behandlung nach dem Herzinfarkt, und zwar mit ACE-Hemmern oder Sartanen, Betablockern und Thrombozytenaggregationshemmern, zu bereits schwer zu verbessernden Ergebnissen führt.
Es muss daher alles getan werden, dass Patienten/innen diese Therapie mit guter Compliance durchführen (siehe auch 14). Für eine zusätzliche Behandlung mit Fischölkapseln ergibt sich derzeit vor allem aufgrund der Omega Studien keine sicher belegte Notwendigkeit (siehe auch 14,15).
Omega Fettsäuren und Alzheimer
Epidemiologische Studien hatten auch einen positiven Effekt von Fischöl auf Alzheimer Patienten/innen angedeutet. Eine prospektive Studie (16) an 402 Patienten/innen über 18 Monate zeigte jedoch, dass Algen Docosahexaensäure den Abfall in den kognitiven Fähigkeiten nicht verringern kann (siehe auch 16a).
Omega Fettsäuren und Schwangerschaft
Auch hier hatten epidemiologische Studien positive Effekte wahrscheinlich gemacht (siehe 17). Eine große Studie (2.399 Patienten/innen: 18) fand aber keinen Effekt auf die postnatale Depression der Mütter oder die kognitive und sprachliche Entwicklung der Kinder (siehe auch 19).
Zusammenfassend:
Es scheint sich für Omega-3 Fettsäuren eine ähnliche Situation wie für Vitamine zu ergeben. Wir haben mehrfach berichtet (Pharmainfo XXII/2/2007, XXIV/2/2009), dass epidemiologische Studien für Vitamin A, B, C, E und Folsäure zahlreiche positive Effekte bei der Verhinderung kardiovaskulärer Erkrankungen bis hin zur Krebsprävention wahrscheinlich machten. Prospektive Studien haben dies klar widerlegt und dies gilt auch für Folsäure bei hohem Homocysteinblutspiegel (Pharmainfo XXV/3/2010). Allerdings ist für eine vitaminreiche mediterrane Ernährung (also Obst, Gemüse, Olivenöl und ein (!) Glas Wein) noch immer eine positive Indikation zu sehen, obwohl wir aus offensichtlichen Gründen als Beleg keine prospektiven und schon gar nicht Doppelblindstudien haben. Ähnliches gilt für öftere Fischmahlzeiten.
Vitaminzufuhr ersetzt also nicht mediterrane Ernährung (oder ist es der Lebensstil?) und Fischöl offensichtlich nicht den Verzehr von Fischen (die ja auch mehrere andere nützliche Nahrungsstoffe enthalten: siehe 20).
Literatur:
(1) Lancet 354,447,1999
(2) Circulation 105,1897,2002
(3) Lancet 372,1233,2008
(4) Lancet 369,1090,2007
(5) JAMA 304,2363,2010
(6) CMAJ 178,157,2008
(7) Lancet 376,540,2010
(8) Thromb Haem 104,664,2010
(9) BMJ 338,a2931,2009
(10) BMC Card Dis 10,24,2010
(11) Clin Cardiol 32,365,2009
(12) NEJM 363,2015,2010
(13) Circulation 122,2152,2010
(13a) BMJ 341,c6273,2010
(14) Circulation 122,2110,2010
(15) Lancet 376,540,2010
(16) JAMA 304,1903,2010
(16a) AM J Alz Dis 25,479,2010
(17) JAMA 304,1717,2010
(18) JAMA 304,1675,2010
(19) Am J Clin Nutr 92,857,2010
(20) Progr Card Dis 52,95,2009
Modafinil (Modafinil Generika, Modasomil)
In einem Referral hat die europäische Zulassungsbehörde EMA eine Neubewertung der Risiko/Nutzenabwägung für Modafinil abgeschlossen (CHMP vom 15. – 18. Nov. 2010, siehe EMA homepage). Die vorhandenen Indikationen wurden eingeschränkt auf die Behandlung von Schläfrigkeit bei Narkolepsie.
In Österreich war Modafinil zusätzlich zu Narkolepsie auch bei obstruktivem Schlafapnoe/Hypnose Syndrom und bei chronischem Schichtarbeiter/innen Syndrom registriert (in anderen Ländern auch noch bei idiopathischer Hypersomnie). Für diese Indikationen stand eine nicht ausreichend belegte Wirkung signifikanten Nebenwirkungen gegenüber. Zusätzlich gab es auch einen häufigen off-label use als stimulierende Substanz.
Diese Nebenwirkungen inkludierten seltene, aber schwere Hauterscheinungen wie Stephens-Johnson-Syndrom, Krämpfe und extrapyramidale Symptome, psychotische Reaktionen einschließlich Suizide und kardiovaskuläre Risiken (Hypertonie und Arrhythmien). Für eine gut belegte Wirkung, wie sie bei Narkolepsie vorliegt, sind unter ärztlicher Überwachung diese Nebenwirkungen vertretbar, bei schlecht belegter Wirkung aber nicht. Von einem off-label use oder missbräuchlicher Verwendung von Modafinil ist aufgrund des Nebenwirkungspotentials dringend abzuraten. Abgesehen davon, vertreiben diese Stimulantien so wie z.B. die Weckamine zwar die Müdigkeit, verbessern aber nicht die Qualität der Leistung.
Zur Pharmakologie des Schnapses
Ausnahmsweise ein nicht sehr medizinisch relevantes Thema, aber durch Publikation im British Medical Journal (341,c6731,2010) „geadelt“.
Eine Schweizer Studie befasste sich mit dem Einfluss von Wein und Schnaps auf ein wohl etwas schweres Essen (Käsefondue). Wein und insbesondere Schnaps verzögerten die Magenentleerung, und Schnaps reduzierte zusätzlich noch die Lust auf ein Dessert. Diese Studie lässt bezweifeln, ob die österreichische, oder genauer gesagt, die Tiroler Sitte einen Zillertaler Schnaps sozusagen als Aperitif zu trinken zweckmäßig ist. Aber vielleicht ist die Intention bei diesem Getränk nicht als Aperitif zu dienen und damit die Säureproduktion und Magenentleerung zu fördern, was geringer konzentrierte alkoholische Getränke erzielen können, sondern den Magen lange voll zu lassen und sich das Dessert zu sparen.
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 31.Jänner 2011
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



