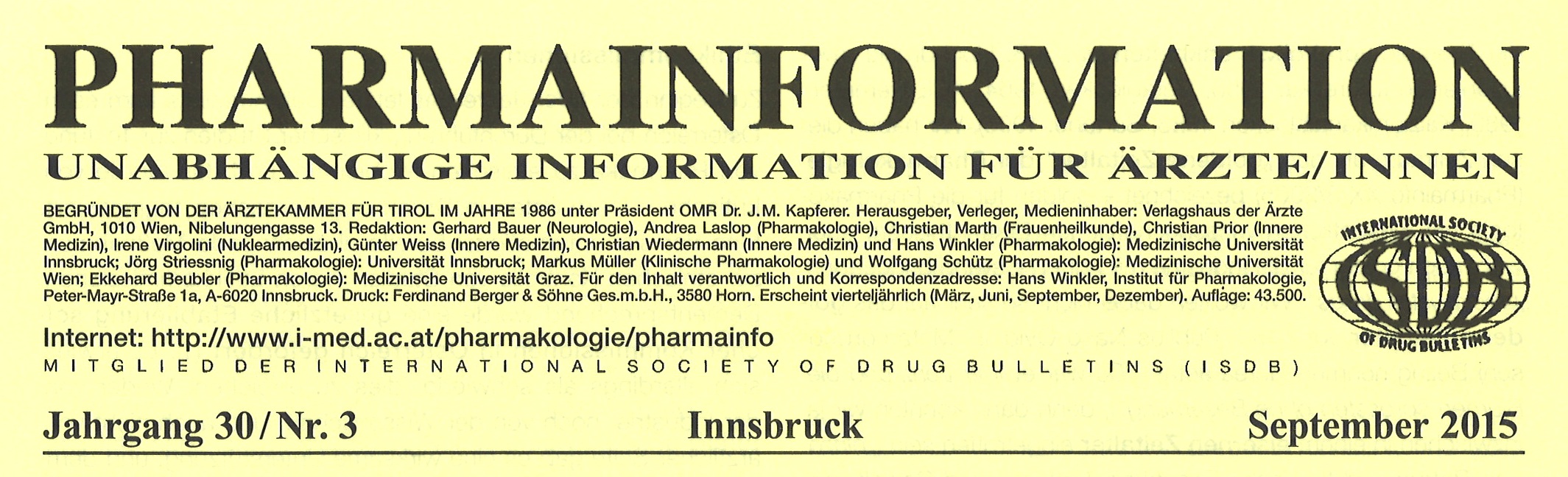
Inhalt
- Vorwort: Dr. A. Wechselberger
- Editorial
- Antidepressiva
- Codein und Dihydrocodein
- Vareniclin (Champix)
- Orale Kontrazeption und Thrombose
- Generikaverschreibung
Vorwort zum Jubiläum 30 Jahre Pharmainformation
von Dr. Artur Wechselberger, Präsident der Tiroler und der Österreichischen Ärztekammer
In der medienrechtlichen Offenlegung der ersten Ausgabe der „Pharmainformation“ von Februar 1986 scheint schon Univ.-Prof. DDr. Hans Winkler als Herausgeber, Verleger und für den Inhalt verantwortlich auf. Prof. Winkler ist es rasch gelungen, diese wissenschaftliche Zeitschrift, die mit Unterstützung der Ärztekammer für Tirol unter der Präsidentschaft meines Amtsvorgängers OMR Dr. J.M. Kapferer gegründet worden war, zu einer Auflage von 45.000 Stück zu entwickeln und damit allen österreichischen Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung zu stellen.
Einer der Gründe des Erfolgs liegt, neben der Konsequenz von Prof. Winkler, auch in der geschickten Auswahl der Mitglieder des Autorenteams. Schon vor Jahrzehnten gelang es ihm, zudem mit der Einbindung der Pharmakologischen Institute der Universitäten Wien und Graz mit Rektor Univ.-Prof. Dr. W. Schütz und Univ.-Prof. Dr. M. Müller bzw. Univ.-Prof. Dr. Beubler zusammen mit Innsbrucker KollegInnen eine gemeinsame Plattform für unabhängige Pharmainformationen zu schaffen.
Wie Prof. Winkler im Vorwort zur ersten Ausgabe schrieb, wolle man kritisch über Medikamente informieren. Dabei sei unter kritisch zu verstehen, dass auch über klinische Daten informiert werde, die die Wirksamkeit mancher Medikamente in Frage stellen oder gefährliche Nebenwirkungen als möglich erkennen lassen. Die „Pharmainformationen“ sollen damit dazu beitragen, die Risiko-Nutzen-Abwägung für die einzelnen Medikamente und dadurch die Auswahl bestimmter Präparate auf eine rationale Basis zu stellen, und die praktisch tätigen Ärztinnen und Ärzte in ihren therapeutischen Entscheidungen unterstützen. Dabei wurde auch auf die klinisch pharmakologische Fachliteratur als Grundlage der Artikel und damit auf deren wissenschaftliche Evidenz verwiesen.
Der rasante Fortschritt der medizinischen Forschung hatte es notwendig gemacht, möglichst objektive medizinisch-wissenschaftliche Informationen bereitzustellen. Dem entsprach die „Pharmainformation“. Sie sollte pharmakologisches Fachwissen mit der bestmöglichen externen Evidenz zur Verfügung stellen. Damals ein zunehmender Trend in der Medizin, der schließlich mit der Entwicklung des Internets in den neunziger Jahren und der damit möglichen weltweiten systematischen Evidenzrecherche einen großen Aufschwung erlebte.
Nicht nur die Tatsache, dass viele der in den Pharmainformationen kritisierten Medikamente mittlerweile längst vom Markt verschwunden sind, zeugt von der Seriosität der Informationen und beweist die Notwendigkeit ihrer Verfügbarkeit. Auch die Entwicklung von Verhaltenskodizes der pharmazeutischen Industrie und der Ärzteschaft, aber auch die Antikorruptionsgesetzgebung der letzten Jahre belegen, dass es vieler Hilfsmittel bedarf, um der Ärzteschaft die Unabhängigkeit in ihrer Verantwortung gegenüber den PatientInnen zu erleichtern.
Für diese Unabhängigkeit stand die Pharmainformation und wird sie hoffentlich noch viele Jahre stehen. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken, die zum Erfolg der „Pharmainformation“ beigetragen haben, ohne dabei auf die Österreichische Ärzteschaft, die mit ihren Beiträgen zur ÖÄK diese Zeitschrift finanziert, und das Verlagshaus der Ärzte, welches die Zeitschrift seit Jahren verlegt und herausgibt, zu vergessen.
Editorial: Dreißig Jahre Pharmainformation in einem sich ändernden (besser werdenden?) Umfeld
Drei Jahrzehnte sind eine lange Zeit; ist es vermessen trotzdem festzustellen, dass sich die Zielsetzung (allerdings wäre zeitgemäßer von einem „mission statement“ zu sprechen) der Herausgeber nicht wesentlich geändert hat?
Aber bevor wir auf unsere Aufgabe eingehen, diskutieren wir Änderungen im Umfeld der Pharmainformation – und das sind Entwicklungen bei der Arzneimittelzulassung, im Arzneimittelmarkt und in den Wechselbeziehungen zwischen pharmazeutischer Industrie und Arzt/Ärztin sowie PatientInnen.
Nur wenn wir dieses Umfeld verstehen, können wir eine rationale Verschreibung von Medikamenten erreichen.
Entwicklungen des Arzneimittelmarktes
Vor 30 Jahren war für Medikamente eine Erfolgsgeschichte bereits voll im Gange. In den Jahrzehnten vorher hatte die Wissenschaft (vor allem im universitären Bereich) bereits zahlreiche pathophysiologische Mechanismen bis hin in den molekularen Bereich mit endogenen Wirkstoffen, Rezeptoren und Enzymen aufgeklärt. Auf dieser Basis konnte die pharmazeutische Industrie neue chemische Substanzen entwickeln, die mit diesen endogenen Molekülen interagierten und damit in pathophysiologische Vorgänge korrigierend eingreifen konnten. Gleichzeitig wurden Studien zur klinischen Wirksamkeit dieser Substanzen durch die wissenschaftliche Erforschung des Placeboeffekts auf eine neue Basis gestellt. Die daraus resultierende Einführung von Doppelblindstudien war ein entscheidender Beitrag zur „evidence based medicine“. Aufgrund dieser Entwicklungen konnten zahlreiche neue Medikamente zur Verfügung gestellt werden, die die Therapie von Volkskrankheiten (wie z.B. Hochdruck) revolutionierten (Diuretika: 1958, Betablocker: 1964, ACE-Hemmer: 1980, Kalziumkanalblocker: 1983, Sartane: 1995). Wir haben diesen Zeitraum als das „goldene Zeitalter“ der Pharmakologie (Pharmainfo XX/3/2005) bezeichnet – golden für die Pharmakologie mit wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber wohl auch goldig für die Industrie mit hohen Gewinn-bringenden „blockbuster drugs“. Wir wollten dabei nicht so sehr auf das goldene Zeitalter von Ovid (Publius Naso Ovidius: Metamorphosen) Bezug nehmen (aurea aetas: „Da war ewiger Lenz und die Blumen sprossten ohne Besamung“), denn dann könnten wir ja inzwischen in einem eisernen Zeitalter eingetroffen sein („einzogen Betrug und tückische Falschheit, Hinterlist und Gewalt und verruchte Begier des Besitzes“). In unserer Gesellschaft folgen wohl nicht Zeitalter in strenger Reihenfolge nacheinander, sondern es existieren gleichzeitig auch im Arzneimittelmarkt „goldene“ und „eiserne“ Charakteristika nebeneinander, und in diesem Sinne ist unsere Diskussion zu verstehen.
In den letzten Jahren gab es Entwicklungen, die den steigenden Gewinnen der Pharmaindustrie in der ersten Blockbuster-Phase entgegenwirkten: Die Zulassung von Medikamenten erfolgte nach immer strengeren Kriterien, die hohe Kosten verursachten. Andererseits waren für viele häufige Erkrankungen bereits fast optimale Therapien gefunden, sodass neue Medikamente in diesem Bereich kaum mehr zu erwarten waren. Dass man z.B. Protonenpumpenblocker mit einem neuen Medikament ersetzen kann, ist schwer vorstellbar.
Für die erfolgsverwöhnten Aktionäre der Pharmaindustrie war dies keine erfreuliche Entwicklung, da sie ihrem Gewinnstreben entgegenwirkt – allerdings ist vielleicht das Wort streben zu positiv besetzt, so mancher denkt da noch an den Satz: „Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“ (J.W. Goethe: Faust II).
Für die Aktionäre, und damit sind nicht so sehr einzelne Individuen sondern anonyme Pensions- und Investmentfonds gemeint, ist der Begriff „Profitmaximierung“ wohl zutreffender (wir verwenden nicht Ovid’s „eisernen“ Begriff: „verruchte Begier des Besitzes“) und daraus ergibt sich natürlich ein starker Druck auf die pharmazeutische Firma vom obersten Management bis hin zu Pharmareferenten in der Peripherie (im Gespräch mit Letzteren jederzeit feststellbar: “Wenn die Umsätze für dieses Präparat in meiner Region nicht steigen, bin ich meinen Job los“).
Ein solcher Druck, der Gewinn zur einzigen Maxime macht, kann in allen gesellschaftlichen Bereichen, und so auch im Arzneimittelmarkt, zu negativen Entwicklungen führen und diese seien im folgenden Spannungsdreieck diskutiert. Bevor wir dies tun, sei noch deponiert (als ein Teil der „goldenen“ Aspekte), dass der pharmazeutischen Industrie der so wichtige Verdienst zukommt, für nahezu alle Erkrankungen sehr wirksame Medikamente entwickelt zu haben.
Pharmaindustrie – Arzt/Ärztin – Patient/Patientin
Der Patient/die Patientin wünscht sich zur Prävention und Therapie seiner/ihrer Krankheiten ein gutes (wirksames und preiswertes) Medikament ohne Nebenwirkungen; Arzt/Ärztin möchte für die Verschreibung zum Nutzen der PatientInnen ebenfalls ein gutes Medikament, realistischer Weise mit vertretbaren Nebenwirkungen; für die Pharmaindustrie ist das Medikament der Weg zum Ziel, i.e. möglichst hohe Gewinne zu erzielen – wenn dies durch gute Medikamente zu erreichen ist umso besser (sogar leichter), aber wie die Vergangenheit zeigt, ist dies auch mit schlechten möglich. Wir wollen im Folgenden nicht so sehr detaillieren, welche negativen Folgen das Gewinnmotiv bedingen kann, sondern positive Maßnahmen besprechen die helfen, die negativen Phänomene in Schranken zu halten.
Ethikkommissionen
Am Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts kam es in Österreich bei der Durchführung klinischer Studien zur Testung von Pharmaka zu ethischen Problemen und das wurde von kritischen Journalisten in Druck und Fernsehen thematisiert. Eine sich international bereits abzeichnende Maßnahme zur ethischen Kontrolle von Studien waren Ethikkommissionen. Dementsprechend wurde eine gesetzliche Etablierung für solche Kommissionen in Österreich gefordert (1). Es erwies sich allerdings als schwierig dies zu erreichen, weder von der Industrie noch von der Wissenschaft und auch nicht von ärztlicher Seite gab es eine wirksame Unterstützung und dementsprechend wurde auch im Arzneimittelgesetz 1984 nur ein Arzneimittelbeirat, aber keine Ethikkommission beschlossen (2). Das Niveau der damaligen Diskussion sei dadurch charakterisiert, dass in einem Entwurf zu diesem Gesetz bezüglich der Einverständniserklärung der PatientInnen für eine klinische Testung vorgeschlagen wurde: „auf diese kann verzichtet werden, wenn sie PatientInnen psychisch zu stark belasten würde (2)“.
Erst 1988 erfolgte dann im Krankenanstaltengesetz eine Inkludierung von Ethikkommissionen und in den 90er Jahren auch im Arzneimittelgesetz (3,4). Heute wissen wir, dass die Einführung von Ethikkommissionen ein ganz wesentlicher Fortschritt für die ethische Durchführung klinischer Studien bedeutete.
Engagement internationaler Fachzeitschriften
Wenn wir gerade noch feststellten, dass in den 80er Jahren vor allem einige kritische Journalisten negative Phänomene im Arzneimittelmarkt anprangerten, dann hat sich das inzwischen deutlich verändert. Schon 2005 (Pharmainfo XX/3) konnten wir berichten, dass sogar internationale Top-Journals sich dieses Themas annahmen und wir zitieren noch einmal 3 repräsentative Titel:
Evidence b(i)ased medicine – selective reporting from studies sponsered by pharmaceutical industry (Brit Med J: 5), Is this company guilty of fraud (Lancet: 6), aber auch und dies ist für eine ausgewogene Darstellung wichtig: Scientist behaving badly (Nature: 7). Noch 3 neuere Titel: Moral decay at N.N. reaps record US Dollar 3 billion fine (Lancet: 8), US judge fines N.N. 1,1 billions for misleading marketing (BMJ: 9), European drug agency criticizes N.N. for failing to report adverse reactions and patient death (BMJ: 10).
Wir sind sicher, dass diese offene und kritische Diskussion in den wissenschaftlichen Spitzenzeitschriften dazu geführt hat, dass die im Folgenden besprochenen Maßnahmen eingeführt wurden und dass sie weiterhin einen entscheidenden Beitrag zu notwendigen Reformen liefern können.
Registrierung von allen klinischen Studien
Das bekannte Phänomen des „publication bias“, das heißt vor allem Studien mit positiven Resultaten werden publiziert, kann offensichtlich die Bewertung des Arzneimittels verfälschen. Die erste wichtige Maßnahme gegen dieses Phänomen war, dass alle klinischen Studien vor Beginn in einem internationalen Register gemeldet werden müssen, sonst können ihre Resultate weder in internationalen Zeitschriften (11) publiziert noch für die Zulassung verwendet werden.
Publikmachung von Studienergebnissen
Die Registrierung von Studien verhindert, dass diese sozusagen „unterschlagen“ werden können, aber sie ermöglicht noch keine Einsicht in die Ergebnisse und ihre Bewertung. Seit 2014 ist auch hier eine neue Situation. Aufgrund von Direktiven der Europäischen Kommission müssen Resultate von klinischen Studien an die European Clinical Trial Database (Eudra CT), die von der EMA (London) verwaltet wird, gemeldet werden und sind dann über das European Union Clinical Trial Register für die Öffentlichkeit zugänglich.
Europäische Zulassung
Wir haben dieses Thema zum 15jährigen Jubiläum der zentralen Zulassung (Pharmainfo XXV/4/2010) etwas ausführlicher behandelt, hier sei nur betont: Für einzelne europäische Länder, dies gilt auch für größere, ist es heute unmöglich, die komplexen Erfordernisse für die Zulassung von ein paar Dutzend Präparaten pro Jahr national zu bewältigen. Nur eine europäische Behörde (EMA in London mit ständigem Personal) und mit der Hilfe von Experten aus 28 Ländern kann gegenüber einer Großfirma mit Milliardenumsätzen und entsprechenden Ressourcen ein effektives Gegenüber bieten. Basierend auf der persönlichen Erfahrung zweier Herausgeber (H. W. und A. L.) der Pharmainformation als langjährige Mitglieder des wissenschaftlichen Entscheidungsgremiums bei der EMA in London (CHMP: Committee for Human Medicinal Products) sei festgestellt, dass eine zentrale Zulassung in London auf hohem wissenschaftlichen Niveau und in offensichtlich gut kontrollierter Unabhängigkeit erfolgt und im Regelfall auch bei einer kritischen Analyse akzeptable Arzneimittelzulassungen bedingt. Diese Feststellung schließt natürlich nicht aus, dass Verbesserungen möglich sind.
Eine weitere positive Folge der zentralen Zulassung ist heute eine hohe Qualität der Fachinformationen, deren Text vom CHMP in London und daher unabhängig beschlossen wird. Wir haben schon einmal darauf verwiesen (siehe Pharmainfo XXVIII/1/2013), dass diese Texte den verschreibenden Ärzten und Ärztinnen als äußerst nützliche Information über Nutzen und Risiken eines Arzneimittels zur Verfügung stehen.
Die zentrale Arzneimittelzulassung, die heuer ihr 20jähriges Jubiläum feiert, kann als eine „Erfolgsstory“ des vereinten Europa betrachtet werden – und sie ist nicht die einzige.
Conflict of interest und Firmensponsoring
Wir setzen als bekannt voraus, dass bei klinischen Studien, aber auch bei Reviews, Metaanalysen und Guidelines finanzielle und andere Relationen der AutorInnen zu Firmen und Sponsoring der Studien durch Firmen in unterschiedlich starker Weise zu einem den Interessen der Firmen dienenden „bias“ in der Planung, Erhebung, Analyse, Interpretation und Präsentation von Studien und deren Daten führen können. Um dies in Publikationen transparent zu machen, verlangen inzwischen die meisten wissenschaftlichen Zeitschriften von den AutorInnen Angaben über einen gegebenen „conflict of interest“. So lesen wir am Ende von Publikationen oft längere Listen über z.B. Honorare für Konsulenten- und Vortragstätigkeit. Aber welche Schlüsse soll der Leser/die Leserin daraus ziehen? Soll er/sie trotz der finanziellen Bezüge an die Unabhängigkeit der AutorInnen, die er/sie meist nicht persönlich kennt, glauben, oder soll er/sie die präsentierten Daten als möglicherweise „biased“ betrachten? Man kann sich oft nicht gegen den Eindruck wehren, dass die „conflict of interest“ Deklaration fast nur eine Alibi-Aktion geworden ist und daher weitere detaillierte Maßnahmen notwendig sind – insbesondere dort, wo neben einem „conflict of interest“ auch noch eine firmengesponserte Studie vorliegt. Zuerst müssen wir allerdings feststellen, dass klinische Studien für neue Medikamente aufgrund ihrer hohen Kosten meist nur durch Firmenfinanzierung möglich sind, und es auch unrealistisch ist zu verlangen, dass z.B. in der Planung und statistischen Auswertung von heute sehr komplexen Studien FirmenvertreterInnen nicht beteiligt sein können. In einer Publikation sollten aber – und dies wird von einzelnen Zeitschriften (siehe z.B. BMJ: Editorial policy: Funding) und AutorInnen bereits durchgeführt – genau der Beitrag und die Mitwirkung der Firma in der Planung, Durchführung, Auswertung und in der Manuskriptverbesserung und der Publikationsentscheidung angeführt werden. KlinikerInnen, die Studien durchführen, sollten darauf bestehen, dass sie in diesen Punkten das letzte Wort haben, und dies sollte in der Publikation stehen. Wenn sie einen guten Ruf haben und die Firma daher die Zusammenarbeit mit ihnen braucht, sollte dies kein Problem sein. Aber wenn in einer Publikation angeführt werden muss, dass zur Verbesserung des Manuskripts ein „writing manager“ von der Firma zur Verfügung gestellt wurde, wäre es wohl empfehlenswert, solche doch eher peinliche Erklärungen von vornherein nicht zutreffend sein zu lassen.
Letztlich sei angemerkt: Wenn jemand einen klaren „conflict of interest“ hat, sollte er/sie Kommentare, Reviews und Metaanalysen zu Medikamenten einer Firma, mit der der „Konflikt“ besteht, nicht verfassen.
Sunshine act
Über die Geldflüsse von der Pharmaindustrie zu Ärzten/Ärztinnen wurde jahrelang spekuliert. Jetzt ist in den USA mit dem sogenannten „sunshine act“ der Weg zur Transparenz beschritten. Ab 30. September 2014 müssen die US-Firmen alle Zahlungen und Zuwendungen an Ärzte/Ärztinnen und Gesundheitsberufe melden, damit sie letztlich publik gemacht werden können (12). Für das Jahr 2014 wurden Zahlungen von 5,9 Milliarden US Dollar gemeldet (an 600.000 Ärzte/Ärztinnen und 1100 Spitäler), davon waren aber immerhin 3 Milliarden für Forschung, 0,64 Milliarden für Aktien und „nur“ 2,3 Milliarden für Konsultations- und Vortragshonorare, Reisekosten, Essen und Unterkünfte (13).
In Österreich hieß es einmal zur Habsburgerzeit: „In meinem Reich geht die Sonne nie unter“. Im verbleibenden kleinen Ursprungsland dieses Imperiums geht die Sonne seit langem wieder unter, für den Arzneimittelmarkt ist zu hoffen, dass bald permanent sunshine eintrifft. Dies kann nicht durch freiwillige Initiativen der Industrie (siehe in Deutschland: 14) oder in einzelnen Ländern geschehen, sondern benötigt einen europäischen, gesetzlichen „sunshine act“.
Entscheidend für die Bewertung von Zuwendungen von Seiten der Pharmaindustrie ist die Frage, ob die Honorierung einer Leistung entspricht.
Aber auch wenn Honorierung und Leistung konform gehen, sollten sich gerade führende KlinikerInnen und WissenschaftlerInnen folgende Frage stellen: Ist nicht die Unabhängigkeit eines Wissenschaftlers/einer Wissenschaftlerin, eines Klinikers/einer Klinikerin ein sehr hohes Gut und sind deswegen Zuwendungen für Konsulententätigkeit und Vorträge (gemeint sind Honorare und nicht Reisekosten) wirklich so erstrebenswert, dass sie die daraus resultierende Relativierung der Unabhängigkeit aufwiegen? Abgesehen vom persönlichen Gewinn durch eine große Unabhängigkeit – ja, man kann darauf sogar etwas stolz sein – besteht dafür auch ein öffentliches Interesse, da die klinische Forschung, die Verfassung von Guidelines (siehe dazu 15,16) und die Zulassungsbehörden (national und internationale) völlig unabhängige ExpertInnen dringend benötigen.
Zielsetzung Pharmainformation 2015
Nach wie vor gilt es für das gute Medikament zu sein und Medikamente mit fraglichem oder negativem Risiko/Nutzen-Verhältnis zu kritisieren. Es geht uns dabei nicht so sehr um die Besprechung möglichst vieler einzelner Medikamente, sondern darum, paradigmatisch Gesichtspunkte aufzuzeigen, die eine korrekte und kritische Analyse von Daten von zugelassenen Medikamenten durch den/die verschreibende/n Arzt/Ärztin ermöglichen.
Obsolete Präparate
Vor 30 Jahren waren zahlreiche Medikamente mit fraglichem Wert auf dem Markt, die in der Folge gegenüber neuen und besseren Medikamenten in den Hintergrund traten, weniger verschrieben und letztlich zurückgezogen wurden, wobei dies aber meist erst durch die Behörden (zuerst Gesundheitsministerium und dann AGES) „angestoßen“ werden musste; vielleicht hat auch die Pharmainfo zu diesem Prozess beigetragen.
In Deutschland sollen Ausgaben für solche obsoleten und umstrittenen Medikamente von 5,1 Milliarden Euro im Jahre 1992 auf 700 Millionen € im Jahre 2013 gesunken sein (17). In Österreich sind nur mehr eine Handvoll von obsoleten Präparaten verblieben, die wir hier gar nicht mehr anführen wollen in der Erwartung, dass durch die AGES auch noch diese pharmakologischen „Peinlichkeiten“ so wie bereits Dutzende andere vom Markt genommen werden.
Neuzulassungen
Die europäische Neuzulassung von Medikamenten erfolgt heute, wie oben diskutiert, grundsätzlich auf einem guten Niveau. Wir können daher eine notwendige Kritik auf Präparate konzentrieren, die schon im Zulassungsprozess (z.B. mit „Kampfabstimmungen“ im CHMP) umstritten waren. Hier sind besonders Fragen der „klinischen Relevanz“ eines Nutzens ein Problemgebiet. Wenn auf Bewertungsskalen von 50 Punkten ein Unterschied zwischen Verum und Placebo von 1 gefunden wird, kann das zwar statistisch signifikant sein (bei großen PatientInnenzahlen), aber noch lange nicht klinisch relevant.
Nach wie vor gibt es Zulassungen vor allem bei Diabetes-Medikamenten und bei Cholesterinsenkern ohne Endpunktstudien. Es hat sich bereits mehrmals gezeigt, dass eine Beeinflussung von Surrogatparametern wie glykosyliertes Hämoglobin oder Cholesterinspiegel wenig über einen klinischen Nutzen (z.B. kardiovaskuläre Mortalität) aussagen.
Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, dass für neue Präparate Vergleichsstudien mit bereits zugelassenen Medikamenten durchgeführt werden müssen. Der Grad des Nutzens eines neuen Medikaments ist daher oft unklar, trotzdem versuchen dann Firmen ihr Präparat als das wirksamere zu propagieren.
Seltene Nebenwirkungen können erst post-marketing erfasst werden. Wenn ein neues Präparat keinen relevanten klinischen Vorteil gegenüber bereits vorhandenen Therapien bringt, mag es „fortschrittlich“ erscheinen das neue zu verschreiben, tatsächlich ist es medizinisch korrekt, ein paar Jahre zuzuwarten, ob wirklich Vorteile und keine überraschenden Nebenwirkungen vorliegen. Offensichtlich ist dies gegen die Strategie der Firma, von Anfang an einen hohen Absatz zu erreichen, lange bevor die Einführung von Generika droht.
Wir verzichten meist darauf, me too-Präparate zu besprechen, wenn sie diese Kriterien erfüllen, bieten sie ja keine Vorteile - es genügt die Formulierung me too – das besser erprobte Original ist daher vorzuziehen.
Dies sind einige Punkte, die zeigen sollen, dass auch bei neu zugelassenen Präparaten eine kritische Bewertung notwendig ist.
Arzneimittelmarkt
Abgesehen von Neuzulassungen gibt es auch bei den bereits etablierten Arzneimitteln immer wieder neue Gesichtspunkte, die einer kritischen Diskussion bedürfen; z.B. können rezente pathophysiologische Erkenntnisse, Resultate von Langzeitstudien und neu erkannte (manchmal erst viele Jahre nach der Zulassung: z.B. Kiefernekrosen bei Bisphosphonaten) Nebenwirkungen Folgen für die Indikationsstellung haben.
Es ist auch immer wieder notwendig, Firmenkampagnen zu kritisieren, die den Absatz eines Medikaments erhöhen sollen, die aber nicht einer objektiven Datenlage entsprechen.
Arzneimittelkosten
In der letzten Zeit werden für Medikamente Preise (bis mehr als 100.000 € pro Behandlung) verlangt, die nicht immer mit dem oft geringen Nutzen in Korrelation zu stehen scheinen, sondern einen Ausdruck des oben diskutierten Einflusses der Aktionäre in der Pharmaindustrie darstellen dürften („Makers of anticancer drugs are profiteering“ say 100 specialists from around the world: 18).
Die Pharmainfo kann zu diesem Thema wenig beitragen, nur eine europäische gesetzliche Lösung kann Preise für Präparate, die Monopolcharakter haben, wenn es für die Erhaltung der Gesundheitssysteme notwendig sein sollte, begrenzen.
Zusammenfassung bzw. Rolle der Ärzte/Ärztinnen
Anstelle einer Zusammenfassung wollen wir Bezug nehmen auf die verschreibenden Ärzte/Ärztinnen, bei denen alle Fäden zusammenlaufen und die deshalb auch aus den vielen oben diskutierten Punkten eine für sie geeignete Synthese machen sollten.
Die Pharmainfo möchte Ihnen paradigmatisch Beispiele zur kritischen Analyse und zur ebensolchen Bewertung des Risiko/Nutzen-Verhältnisses von einzelnen Arzneimitteln bieten, die analog auch auf andere angewandt werden können, und wenn notwendig aufzeigen, wie externe Kräfte Ihr Verschreibungsverhalten, nicht immer im Interesse der PatientInnen, zu beeinflussen suchen.
Editoriales Vorgehen
Die Herausgeber sind ehrenamtlich tätig. Artikel ohne AutorInnen wurden von einem Herausgeber verfasst. Diese Artikel und auch die namentlich gezeichneten (von externen AutorInnen) werden von allen Herausgebern diskutiert und redigiert. Damit dürfte auch sichergestellt sein, dass ein „conflict of interest“ einer einzelnen Person nicht zum Tragen kommen kann.
Dank
Nur eine kompetente (und auch amikale) Zusammenarbeit aller Herausgeber hat die Pharmainformation über 30 Jahre möglich gemacht.
Besonderer Dank gilt der Tiroler und der Österreichischen Ärztekammer (insbesondere dem Präsidenten Dr. A. Wechselberger), die eine völlig unabhängige Publikation ermöglicht haben. Dem Verlagshaus der Ärzte (insbesondere Mag. Hagen Schaub) sei für die effiziente Drucklegung und Univ.-Prof. Dr. Reiner Fischer-Colbrie für die Präsentation im Internet mit Sachwörterregister gedankt. Eine über 30 Jahre dauernde optimale administrative Betreuung verdanken wir Frau Monika Viehweider.
Literatur:
(1) H. Winkler: Parlament. Enquete Wien, 3. Juni 1981
(2) H. Winkler: KSÖ Nr. 13, 7.7.1984, S. 3 – 4
(3) H. Winkler: Pharmig Info 12, S.11 (1988)
(4) H. Winkler: Jahrbuch Arbeitskreis med. Ethik-Kommission 1990, Hrsg: R. Toelner, S. 191
(5) BMJ 326,1171,2003
(6) Lancet 363,1919,2004
(7) Nature 435,737,2005
(8) Lancet 380, 2,2012
(9) BMJ 344,e2772,2012
(10) BMJ 344,e4344,2012
(11) NEJM 352,2436,2005
(12) NEJM 368,2054,2013
(13) BMJ 351,h3697,2015
(14) DAZ 154,22,2014
(15) BMJ 347,f4498,2013
(16) Dtsch Ärztebl Int 109,836,2012
(17) Arzneimittelreport, U. Schwabe, 2014
(18) BMJ 346,f2810,2013
Rationale Verschreibung von Antidepressiva: Einige Kriterien
Martin Bauer, Universitätsklinik für Klin. Pharmakologie, Med. Universität Wien
Bis zu 17% aller Menschen erleiden zumindest einmal im Verlauf ihres Lebens eine klinisch relevante depressive Störung (Dauer der Symptome über 2 Wochen). Die 1-Jahres-Prävalenz für das Vollbild der Erkrankung „Major Depression“ liegt bei 6,9% (1). Bei einer Major Depression leiden die betroffenen PatientInnen unter einer definierten Palette an Symptomen wie depressiver Stimmung, Interessensverlust, Antriebsminderung und erhöhter Ermüdbarkeit. Typischerweise bestehen auch ein Verlust des Selbstwertgefühls und Gefühle von Wertlosigkeit und Schuld. Suizidgedanken und -handlungen sind häufig, und meist liegen auch somatische Symptome vor. Der Verlauf ist phasenweise und die depressive Stimmung dauert mindestens zwei Wochen an.
Antidepressiva der ersten Generation sind trizyklische Antidepressiva (TCA, z.B. Clomipramin: Anafranil, Amitriptylin: Saroten, Maprotilin: Ludiomil) und MAO-Hemmer (Moclobemid: Generika, Aurorix). Als Antidepressiva der 2. Generation stehen selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer [SSRI: Fluoxetin (Generika, Fluctine), Citalopram (Generika, Seropram), Paroxetin (Generika, Seroxat), Sertralin (Generika, Tresleen), Fluvoxamin (Floxyfral), Escitalopram (Generika, Cipralex)] und selektive Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer [SNRI: Venlafaxin (Generika, Efectin), Duloxetin (Generika, Cymbalta, Yentreve), Milnacipran (Ixel)] zur Verfügung. Zu den Antidepressiva mit anderen Wirkmechanismen werden Mianserin (Generika, Tolvon), Mirtazapin (Generika, Remeron), Bupropion (Wellbutrin), Reboxetin (Edronax), Trazodon (Trittico), Tianeptin (Stablon), Agomelatin (Valdoxan) und Vortioxetin (Brintellix) gezählt.
Bei den nationalen Verordnungen liegen SSRIs mit 58,4% vor SNRIs und anderen Antidepressiva (zusammen 34,5%), es folgen MAO-Hemmer (3,6%) und Kombinationspräparate (3,5%: 2).
Wie wird eine antidepressive Wirkung gemessen?
In den meisten klinischen Studien wird heute die antidepressive Wirkung mit der sogenannten Hamilton Depression Scale (HAMD-Score) bewertet.
In dieser Fremdbeurteilungsskala werden meist 17 (aber auch bis 24) Kategorien wie depressive Stimmung, Schuldgefühle, Suizidalität und Schlafstörungen mit einer Punkteskala (0 bis 2 oder 4) vom Untersucher darauf beurteilt, wie schwer diese ausgeprägt sind. Ab einer Gesamtsumme von 10 bis 20 ist eine leichte, ab 20 eine mittelschwere, ab 30 schwere Depression gegeben.
Man spricht in einer Studie von einer Ansprechrate (response rate), wenn bei den Daten die Werte in dieser Skala um mehr als 50% abfallen und von einer Remission bei unter 10 Punkten. In typischen klinischen Studien (siehe z.B. eine Meta-Analyse: 3) fallen etwa die Werte dieser Skala nach 6 Wochen von einem Ausgangswert von über 20 um 11,82 für Verum und 9,26 für Placebo, was eine Differenz von 2,55 Punkten ergibt. Als klinisch relevant wird ein Unterschied von 3 angesehen (4). Diese Differenz erscheint auf einer Skala von mindestens 34 nicht besonders groß, etwas eindrucksvoller erscheint der Prozentsatz der Ansprechraten (Abfall um mindestens 50%), die für die PatientInnen in diesem Beispiel 58,4% für Verum und 39,9% für Placebo waren, also verglichen mit Placebo hatten ca. 20% der PatientInnen durch das Medikament eine sehr deutliche Besserung.
Ist die Wirkung der Antidepressiva abhängig vom Schweregrad der Depression?
Zu dieser Frage kam eine Meta-Analyse von 35 für die FDA eingereichten Studien zu dem Schluss (5), dass Antidepressiva nur bei schweren Depressionen eine relevante Wirkung zeigen (für eine Kritik dieser Studie siehe 6).
Eine Meta-Analyse basierend auf den Daten einzelner PatientInnen hingegen fand, dass die Ansprechrate auf die antidepressive Therapie zwar abhängig vom Schweregrad der Depression, aber bei allen Graden gegeben war; so lag die Number Needed to Treat (NNT) bei leichter depressiver Episode bei ca. 16, bei mittelgradiger bei ca. 11 und bei schwerer bei ca. 4 (7). Eine rezentere Meta-Analyse mit gleicher Methodik (3) aber mehr PatientInnen (n = 2635) fand für schwere Depressionen (> 20 Hamilton Score) nach 6 Wochen eine Differenz im Score von 2,8 zwischen Placebo und Verum, für leichtere (unter 20) eine nur etwas niedrigere von 2,2, sodass die AutorInnen keinen klaren Bezug zwischen Schwere der Depression und antidepressiver Wirkung sahen. Diese Daten schließen aber nicht aus, dass bei einem Score von unter 18 und weniger, die Wirkung so wie in der anderen Analyse abnimmt.
Offensichtlich sind die Daten nicht eindeutig, eine zumindest schwache Wirkung der Antidepressiva bei leichten Depressionen dürfte aber gegeben sein. Auf jeden Fall sind bei leichten Depressionen auch andere Therapien in Erwägung zu ziehen.
Bei leichten depressiven Episoden sind Psychoedukation oder Psychotherapie sogar die effizienteren Behandlungsalternativen im Vergleich zu Antidepressiva (8). Leitlinien (4,9) empfehlen daher für leichte Depressionen diese als günstigere Alternative.
Therapiedauer und Compliance
Wenn ein Antidepressivum nach 3 – 4 Wochen zu keiner Besserung der Symptome führt, sollte ein Wechsel auf ein anderes Präparat überlegt werden (2).
Nach Remission der depressiven Episode sollte die antidepressive Medikation für weitere 4-9 Monate eingenommen werden (mindestens 6 Monate: 4, 4-8 Monate: 9). PatientInnen mit zwei oder mehr depressiven Episoden mit bedeutsamen funktionellen Einschränkungen in der jüngeren Vergangenheit sollten dazu angehalten werden, das Antidepressivum mindestens zwei Jahre lang zur Langzeitprophylaxe einzunehmen (4, 9).
Nur 44,3% der PatientInnen mit Major Depression nehmen das verschriebene Antidepressivum länger als sechs Monate ein.Zwei Drittel der PatientInnen, die das Medikament absetzen, tun dies ohne ärztliche Rücksprache (10). In einer PatientInnenumfrage zur Einnahme von Antidepressiva wurden folgende Gründe für mangelnde Compliance angegeben (Häufigkeit absteigend): Vergessen der Einnahme, sexuelle Nebenwirkungen, Tagesmüdigkeit und Gewichtszunahme (11). Hinsichtlich der Therapie-Adhärenz und Verschreibungspraxis bei Erstverschreibung von Antidepressiva in Österreich ist anzumerken, dass 49,9% der PatientInnen lediglich eine Packung eines Antidepressivums innerhalb des Beobachtungszeitraumes von drei Quartalen einlösten (2).
Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen
Zwei Themen waren in den letzten Jahren kontroversiell:
(i) Sind Antidepressiva bei diesen PatientInnen wirksam? Hierzu wurde eine Debatte ausgelöst, als die Verlässlichkeit einer positiven Studie für Paroxetin angezweifelt wurde (siehe 12). Tatsächlich zeigte eine jetzt (11a,b) veröffentlichte Studie auf, dass eine korrekte Analyse der damaligen Daten keinen Effekt und signifikante Nebenwirkungen im Vergleich zu Placebo für Jugendliche ergab.
Wir können heute Folgendes feststellen (siehe 13,14): SSRI und SNRI haben bei Kindern eine antidepressive Wirkung, diese ist aber inkonsistent und nur für Fluoxetin („the only SSRI for which there was consistent evidence of its effectiveness“: 13) verlässlicher, für andere Antidepressiva (SSRI, SNRI, Venlafaxin und Mirtazapin) ist die Wirkung schwach, für Paroxetin ist keine Wirkung vorhanden (14).
Bei Kindern ab 8 Jahren ist Fluoxetin als einziges Antidepressivum zur Behandlung von mittelgradigen bis schweren Episoden einer Major Depression, sofern die Depression nach 4–6 Sitzungen nicht auf eine psychologische Behandlung anspricht, zugelassen. Der Off-Label Einsatz von TCA ist aufgrund der aktuellen Datenlage nicht zu empfehlen (15).
(ii) Führen Antidepressiva bei diesen PatientInnen zu einem erhöhten Suizidrisiko?
Im Jahre 2004 wurde sowohl von der FDA (black box warning) als auch der EMA in London (9. Dez. 2004) vor einer erhöhten Suizidgefahr bei Kindern und Jugendlichen unter SSRI- und SNRI-Therapie gewarnt. Über die nachfolgenden Jahre kam es zu kontroversen Diskussionen wie „Should the use of SSRI for children be banned?“ (16) bis zu „Benefits appear to be much greater than risks” (17: NNT: 10; NNH: 112) oder „the warning should be removed” (18).
Was können wir heute aussagen?
Einerseits wurde im Vergleich zu Placebo in einer Meta-Analyse für ein Kinder- und Jugendpsychiatrisches Kollektiv (3229 PatientInnen, 17 Studien) unter der Einnahme von Antidepressiva eine 58%ige Zunahme von Suizidgedanken und Suizidalen Handlungen festgestellt; es wurde jedoch kein erfolgter Suizid registriert (14). Andererseits geht der vermehrte Einsatz von Antidepressiva mit einer Abnahme der registrierten Suizide sowohl bei 10 – 19-Jährigen (19,20) als auch bei Erwachsenen einher (21).
Für die praktische Therapie heißt dies: Je schwerer die Depression, umso effektiver ist die Verhinderung von durch die Depression ausgelösten Suiziden durch Antidepressiva.
Welches Antidepressivum verschreiben?
Die trizyklischen Antidepressiva (TCA) der ersten Generation haben eine mit den neuen Präparaten vergleichbare Wirkung, (NNT 9 versus 7 für SSRI: 22), aber ein ungünstigeres Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil. Die Number Needed to Harm (NNH) für Therapieabbruch aufgrund von Nebenwirkungen schwankte für TCA von 4 bis 30 und für SSRIs zwischen 20 und 90 (23). Zu den häufigsten Nebenwirkungen bei TCA zählen anticholinerge Nebenwirkungen wie Sedierung, Mundtrockenheit, Obstipation, Akkommodationsstörungen, Miktionsstörungen. Ein relevanter Nachteil ist die hohe Letalität bei suizidalen Vergiftungen (23).
Die SSRI und in weiterer Linie SNRI sind Mittel erster Wahl (4,9) bei Depressionen. Im Durchschnitt kommt es allerdings nur zu einer Ansprechrate von 63% und zu einer Remission bei 47% (24).
Unter Therapie mit SSRIs kommt es häufig zu Übelkeit und Erbrechen, sexuellen Funktionsstörungen, Nervosität, Erregung und Schlafstörungen. Zu möglichen Nebenwirkungen unter SNRI-Einnahme zählen Übelkeit und Erbrechen, Blutdruckerhöhung, Gewichtszunahme und Schlafstörungen.
In einer Meta-Analyse (234 Studien) zum Nutzen/Risiko-Profil von 13 neueren Antidepressiva (Bupropion, Citalopram, Desvenlafaxin (in Österreich nicht zugelassen), Duloxetin, Escitalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, Mirtazapin, Nefazodon (in Österreich nicht zugelassen), Paroxetin, Sertralin, Trazodon und Venlafaxin) fanden sich keine klinisch relevanten Unterschiede in der Wirksamkeit bei der Behandlung einer Major Depression. Eine Subgruppenanalyse zeigte auch keine Unterschiede in der Wirkung betreffend Begleitsymptome, höheres Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder Begleiterkrankungen (24).
Nebenwirkungen waren insgesamt bei allen Antidepressiva ähnlich, einzelne Substanzen hatten aber bei einigen höhere Frequenzen (24). So waren Übelkeit und Erbrechen bei Venlafaxin höher, Diarrhoe bei Sertralin, Gewichtszunahme bei Mirtazapin und Somnolenz bei Trazodon, während Nebenwirkungen im Sexualbereich bei Paroxetin häufiger und Bupropion seltener waren.
Die Abbruchraten wegen Nebenwirkungen waren ebenfalls für alle Substanzen ähnlich, nur Duloxetin und Venlafaxin hatten etwas höhere Werte (24).
Auch bezüglich der Beeinflussung von Begleitsymptomen wie Angst, Schlaflosigkeit und Schmerz zeigten sich keine relevanten Unterschiede für diese 13 Präparate (24; siehe auch 25).
All diese Daten zu Wirkungen, Nebenwirkungen und Begleitsymptomen zeigen, dass Firmen zwar versucht haben, für ihre Präparate besondere Vorzüge zu reklamieren, dass aber eine solide wissenschaftliche Basis dafür fehlt (siehe auch 26).
Dies war aber in der Vergangenheit nicht immer leicht zu erkennen, da eine bevorzugte Publikation von positiven Studien erfolgte. Ein „Publication bias“ wurde für Antidepressiva mehrfach festgestellt. So waren in einer Analyse (27) von 40 publizierten Studien 37 mit positiven Resultaten, während von den 33 negativen Studien 22 nicht publiziert waren und bei den restlichen 11 versucht wurde, einen positiven Eindruck zu erzeugen („conveying a positive outcome“).
Aufgrund dieser Gegebenheit kann eine Auswahl eines Antidepressivums auch nach ökonomischen Gesichtspunkten erfolgen, bezüglich Nebenwirkungen sind individuelle Faktoren bei PatientInnen zu berücksichtigen und man wird z.B. wenn eine gewisse Nebenwirkung wie Gewichtszunahme auftritt, bei einem notwendigen Wechsel nicht ein Präparat wählen, bei dem diese Nebenwirkung häufiger ist.
Im Folgenden werden noch Antidepressiva besprochen, die nicht in der oben zitierten Meta-Analyse erfasst wurden.
Ein fragliches Nutzen/Risiko-Verhältnis besteht für Agomelatin. Für diese Substanz, ein Melatoninagonist, wurde in einer rezenten Pharmainfo (Pharmainfo XXIX/4/2014) festgestellt, dass Meta-Analysen, insbesondere wenn nicht publizierte Studien einbezogen werden, gegen eine klinisch relevante Wirkung dieser Substanz sprechen. Zusätzlich ist dieses Präparat durch Lebertoxizität belastet. Eine möglicherweise geringere Beeinflussung sexueller Funktionen hebt diese Nachteile nicht auf.
Auch für Reboxetin gilt, dass bei Einbeziehung unveröffentlichter Daten eine Meta-Analyse (28) keinen klinisch relevanten Effekt auf Ansprechraten und Remission zeigte („is overall an ineffective drug“; laut einer anderen Analyse soll ein „small benefit“ gegeben sein: 29).
Für Mianserin sind keine Vorteile bekannt, ein gravierender Nachteil ist das Agranulozytoserisiko (30; siehe Pharmainfo III/1/1988) mit daher erforderlichen Blutbildkontrollen (siehe Fachinformation).
Tianeptin ist chemisch den TCA zuzurechnen. Ob es sich im Wirkungsmechanismus von diesen unterscheidet ist unklar, anticholinerge Nebenwirkungen sind wie bei den TCA auf jeden Fall gegeben (siehe Fachinformation). Leberschäden, bis zu schwerwiegenden Fällen, sind beschrieben (31, siehe auch Fachinformation).
Für Milnacipran, das zu den SNRI zu zählen ist, sind keine besonderen Vor- oder Nachteile bekannt. Ein Antrag der Firma auf Zulassung für die Behandlung der Fibromyalgie wurde in Europa (nicht in den USA) abgelehnt, nicht wegen besonderer Nebenwirkungen, sondern wegen fraglicher Wirkung bei dieser Erkrankung (Refusal Assessment Report, EMA, 2010).
Der Wirkmechanismus von Vortioxetin, das kürzlich eine europäische Zulassung erhalten hat, dürfte mit dessen direkter Modulation der serotonergen Rezeptoraktivität und Hemmung des Serotonin-Transporters zusammenhängen. Laut dem europäischen Assessment Report (EPAR, EMA, 2013) ist die antidepressive Wirkung durch mehrere Studien belegt (ein Drittel davon waren negativ: „however negative studies are not uncommon“). Der Versuch der Firma, für diese Substanz neue Wirkungsmechanismen zu postulieren mit spezieller Wirkung auf kognitive Funktionen, war nicht überzeugend - „have not yet been convincingly demonstrated“.
Die am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen waren Übelkeit (32; NNH gegenüber Placebo: 6), Erbrechen (NNH: 28) und Verstopfung (NNH: 64). Sexuelle Dysfunktionen waren ähnlich denen von SSRI (33). Da es derzeit keine Belege für spezifische Vorteile dieser Substanz gibt, spricht nichts für die Verwendung eines noch wenig erprobten Medikaments (siehe auch 34).
Sexuelle Funktionsstörungen
Diese äussern sich als verändertes sexuelles Verlangen, Orgasmus-, Ejakulations- und Erektionsstörungen und sind eine relativ häufige Nebenwirkung von Antidepressiva. Relevant für die Pharmakologie von Antidepressiva ist, dass eine Stimulation der 5HT2A-Rezeptoren negative Auswirkungen auf die Sexualfunktion hat (35). Sexuelle Nebenwirkungen sind in über einem Drittel der Fälle Grund für das Absetzen oder Wechseln der SSRI-Medikation (36). Kommt kein Wechsel auf ein anderes Antidepressivum wie z.B. Bupropion (24, siehe auch 37) oder Mirtazapin (38) in Frage, ist eine breite Palette von Management-Strategien möglich, welche Verhaltensmodifikation, psychologische und pharmakologische Ansätze umfassen. Für Männer mit Antidepressiva-induzierter erektiler Dysfunktion ist die Gabe von Sildenafil (Generika, Viagra) oder Tadalafil (Cialis) eine wirksame Strategie (39). Für Frauen mit Antidepressiva-induzierter sexueller Dysfunktion ist Add-on von Bupropion in höherer Dosierung der vielversprechendste Ansatz (39).
Zusammenfassung
Die medikamentöse Behandlung einer mittelschweren bzw. schweren depressiven Episode sollte als Monotherapie mit einem SSRI als First-Line-Therapie erfolgen, gefolgt von SNRIs und Tetrazyklischen Antidepressiva. Für Agomelatin, Reboxetin, Tianeptin und Mianserin liegt ein unklares Nutzen/Risiko-Verhältnis vor. Zu Beginn der Antidepressiva-Therapie kann es vor allem bei Kindern zu verstärktem Auftreten von Suizidgedanken und -Handlungen kommen. Trotzdem kommt es bei vermehrtem Einsatz von Antidepressiva zu einer Abnahme der registrierten Suizide von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Die klinische Wirksamkeit der verschiedenen Substanzen ist sowohl zwischen den verschiedenen Substanzgruppen als auch innerhalb der Gruppen ähnlich. Die Auswahl des Antidepressivums soll weitgehend nach dem jeweiligen Nebenwirkungsprofil, der individuellen Verträglichkeit, Vorerfahrungen und Erwartungen der Betroffenen, sowie der aktuellen wissenschaftlichen Datenlage unter Einbeziehung ökonomischer Gesichtspunkte erfolgen. Sexuelle Nebenwirkungen sind ein häufiger Grund für Therapieabbruch.
Literatur:
(1) Eur Neuropsychopharmacol 21,655,2011
(2) OÖGKK Arzneidialog 1,2010
(3) Arch Gen Psych 69,572,2012
(4) NICE guidelines [CG90] 2009
(5) PloS Med 5,e45,2008
(6) Ann Gen Psych 12,26,2013
(7) JAMA 303,47,2010
(8) World J Biol Psychiatry 14,334,2013
(9) S3-Leitlinie/NVL Unipolare Depression,2009
(10) BMC Psychiatry9,38,2009
(11) Curr Ther Res Clin Exp 66,96,2005
(11a) BMJ 351,h4320,2015
(11b) BMJ 351,h4629,2015
(12) BMJ 347,f6754,2013
(13) Curr Opin Psych 23,53,2010
(14) Cochrane Database Syst Rev issue 11,CD004851,2012
(15) Cochrane Database Syst Rev issue 6,CD002317,2013
(16) Psychother Psychosom 76,5,2007
(17) JAMA 297,1683,2007
(18) NEJM 371,1666,2014
(19) Arch Gen Psych 63,865,2006
(20) BJ Psych 196,429,2010
(21) Acta Psychiatr Scand 119,236,2009
(22) Cochrane Database Syst Rev issue 3,CD007954,2009
(23) BMJ 344,d8300,2012
(24) Ann Intern Med 155,772,2011
(25) Dep & Anx 29,495,2012
(26) DMW 139,1727,2014
(27) NEJM 358,252,2008
(28) BMJ 341,c4737,2010
(29) DTB 49,122,2011
(30) BMJ 291,1638,1985
(31) Am J Psychiatry 171,404,2014
(32) Int J Clin Pract 68,60,201
(33) J Clin Psych 76,1,2015
(34) Med Lett Drugs Ther 55,93,2013
(35) Neuropsychopharmacology 31,2281,2006
(36) Ann Pharmacother 36,578,2002
(37) Drug Saf 37,19,2014
(38) Cochrane Database Syst Rev issue 12,CD006528,2011
(39) Cochrane Database Syst Rev issue 5,CD003382,2013
Codein und Dihydrocodein (Paracodin) als Hustenmittel bei Kindern
Wir haben in der letzten Pharmainfo (XXX/2/2015) berichtet, dass aufgrund eines EMA-Referrals (13.03.2015) für Codein als Antitussivum (Codipertussin) eine Kontraindikation für Kinder unter 12 Jahren festgelegt wurde.
Dazu hat nun R. Kürsten, ein HNO-Arzt aus Wien, folgendes geschrieben: „Diese Entscheidung ist aus Sicht eines HNO-Arztes äußerst unbefriedigend. Es gibt bei Kindern quälenden, trockenen Reizhusten, der Stunden, ja manchmal einige Tage Kinder und Eltern leiden lässt. Da helfen vermehrte Flüssigkeitszufuhr und andere Maßnahmen nicht, und wenn Experten feststellen (siehe Referralaussendung 13.03.2015), dass der Husten selbstlimitierend ist, dann könnten wir ja sehr oft die Hände in den Schoß legen“. Wir sind für diesen Kommentar dankbar, zeigt er doch, dass eine einfache Mitteilung des Referral-Resultats, ohne genauere Analyse und Besprechung der Konsequenzen, unzureichend war.
Schon 2013 wurde in einem Referral (EMEA/H/A-31/1342) für Codein als Analgetikum (in Österreich als Analgetikum nicht registriert) eine Kontraindikation für Kinder unter 12 Jahren festgelegt. Es lagen eindeutige Daten vor, dass auch bei normaler Dosierung im Bereich von 1 – 6 mg/kg/Tag (1,2) es bei Kindern zu schwerwiegenden Komplikationen bis zu Todesfällen kommen kann. Als Ursache konnte gezeigt werden, dass bei diesen Kindern ein „ultrarapid metabolism genotype“ vorlag. Codein wird nämlich im Organismus z.T. über das Cytochrom CYP2D6 zu Morphin mit stärkerer Wirkung abgebaut. Bei 1 – 7% der Kinder ist dieses Enzym genetisch bedingt überaktiv und daher erfolgt diese Umwandlung „ultrarapid“ und führt zu toxischen Morphinspiegeln. Eine Kontraindikation für Kinder, die auf Morphin besonders empfindlich reagieren, ist daher berechtigt und auch kein Problem, da es genügend analgetische Alternativen gibt. Theoretisch könnte man natürlich auch den CYP2D6 Genotyp, der auch für den Stoffwechsel anderer Medikamente von Bedeutung ist, feststellen. Dies kann in Österreich von pharmakogenetischen Labors gemacht werden, ist aber zumindest für Codein bei Kindern nicht praktikabel.
Zur Hustenbehandlung sind die empfohlenen Codeindosen niedriger (bis 1 mg/kg/Tag: 3). Man wird also auch bei „ultrarapider Metabolisierung“ ein geringeres Risiko erwarten. Tatsächlich sind zwar Fälle von Komplikationen bei normalen Dosen beschrieben (z.B. 4), der Großteil aber nur bei Überdosierung (z.B. 5). Die Datenlage ist hier also nicht so eindeutig, trotzdem erscheint es berechtigt, bei Kindern mit einer nicht gefährlichen Erkrankung kein Risiko von schweren Nebenwirkungen einzugehen.
Welche medikamentösen Alternativen verbleiben dann in Österreich?
Zugelassen für Kinder ist Dihydrocodein (Paracodin). Da es sich hier um ein nur geringfügig verändertes Codeinderivat handelt, würde man die gleichen Probleme wie bei Codein erwarten. Für Dihydrocodein sind Intoxikationen beschrieben, aber nicht bei Verwendung als Antitussivum, sondern bei Missbrauch in der Suchtszene (6). Dihydrocodein wird teilweise zwar auch über CYP2D6 zu Dihydromorphin metabolisiert, trotzdem sprechen die meisten Studien dafür, dass sowohl die analgetische (7), als auch die toxische (6) Wirkung von Dihydrocodein unabhängig von unterschiedlichen Aktivitäten von CYP2D6 sind. Bei richtiger Dosierung hat daher Dihydrocodein als Antitussivum ein positives Risiko/Nutzen-Verhältnis.
Damit steht Dihydrocodein in Österreich für Kinder, man möchte fast sagen, wider Erwarten, weiterhin zur Verfügung und damit hat der Kommentar von Dr. Kürsten eine nützliche Information induziert. Die Analyse der Literatur zeigt aber deutlich auf, dass auch diese Substanz bei Kindern einer genauen Dosierung bedarf. Insbesondere Tropfen vermitteln aber den Eindruck eines „harmlosen“ Medikaments, zusätzlich ist auch die Dosierung von Tropfen schwierig. Eine genaue Information der Eltern erscheint daher wichtig.
Literatur:
(1) NEJM 361,827,2009
(2) Pediatrics 129,e1343,2012
(3) Pediatrics 99,918,1997
(4) J Opioid Manag 9,151,2013
(5) Eur J Pediatr 168,819,2009
(6) J Anal Tox 34,476,2010
(7) Pharmacology 87,274,2011
Raucherentwöhnung und Vareniclin (Champix)
Wir haben berichtet, dass für dieses Mittel 2. Wahl zur Raucherentwöhnung (1. Wahl: Nikotinersatzpräparate) Hinweise auf psychiatrische Nebenwirkungen wie Depression, Suizidgedanken und Agitation und auch kardiovaskuläre Risiken vorliegen (Pharmainfo XXVIII/3/2013). Zwei große Studien mit unterschiedlicher Methodik: (i) eine Metaanalyse (1) von 44 randomisierten Studien mit 5.817 PatientInnen und (ii) eine Beobachtungsstudie (2) mit 69.757 Vareniclin-VerwenderInnen, haben jetzt keinen Beleg für psychiatrische Nebenwirkungen gefunden. Da Raucherentwöhnung selbst zu solchen Symptomen führen kann, ist es wichtig zu wissen, dass Vareniclin diese anscheinend nicht aggraviert. Eine weitere sehr große (n = >15.000) retrospektive Kohortenstudie (3) fand weder für psychiatrische noch für kardiovaskuläre Nebenwirkungen ein im Vergleich zu Nikotinersatzpräparaten erhöhtes Risiko.
Die wichtigste Unterstützung für eine Raucherentwöhnung kommt von Maßnahmen, die Rauchen in der Öffentlichkeit zum Verschwinden bringen. Als einer der letzten Staaten Europas soll das für Österreich ab 2018 aktuell werden. In Peking (23 Mio. Einwohner, davon 52,9% rauchende Männer, aber nur 2,4% – sic! – Frauen), wurden bereits am 1. Juni 2015 alle internen öffentlichen Räume rauchfrei (dazu tituliert Lancet: „taming the smoking dragon“: 4).
Literatur:
(1) BMJ 350,h1109,2015
(2) BMJ 350,h2388,2015
(3) Lancet Sept. 7,2015,online
(4) Lancet 380,2123,2015
Orale Kontrazeption und Thromboserisiko
Wir haben mehrfach (Pharmainfo XXVI/3/2011; XXVII/4/2012; XXIX/1/2014) darüber berichtet, dass das Thromboserisiko für orale Kontrazeptiva (Östrogen und Gestagen) je nach verwendetem Gestagen unterschiedlich ist. Eine neue große Studie (1) hat nun die Daten von über 1.300 Arztpraxen in England mit über 10.000 Thrombosefällen ausgewertet.
Kurz zusammengefasst: Pro 10.000 Frauen pro Jahr kommt es mit den Gestagenen Norethisteron (in Österreich nicht registriert), Levonorgestrel (zahlreiche Präparate) und Norgestimat (in Österreich nicht registriert) zu 6 bis 7 zusätzlichen Thrombosefällen (30% mit Pulmonalembolie), bei Desogestrel (zahlreiche Präparate), Gestoden (zahlreiche Präparate), Drospirenon (zahlreiche Präparate) und Cyproteron (zahlreiche Präparate) zu 11 – 14 Fällen (ca. 4 Lungenembolien). Diese Daten bestätigen überzeugend (siehe auch Editorial: 2) die Resultate zweier früherer Studien (Pharmainfo XXVI/3/2011).
Eine Verschreibung von Substanzen, die ein höheres Thromboserisiko einschließlich Lungenembolie haben, aber keinen überzeugend belegten Vorteil besitzen, ist schwer vertretbar. Tatsächlich konnten wir bereits berichten, dass z.B. die Verschreibung von Drospirenon-hältigen Präparaten in Deutschland 2013 um 29,5% abgenommen hat (Pharmainfo XXX/1/2015).
Literatur:
(1) BMJ 350,h2135,2015
(2) BMJ 350,h2426,2015
Generikaverschreibung
Wir sind bereits mehrfach für die Verschreibung von Generika eingetreten (Pharmainfo XXIV/2/2009; XXI/3/2006; XX/1/2005) und diese ist in Österreich in den letzten Jahren auch deutlich angestiegen. Wir haben die Ansicht vertreten, dass die ärztlich-medizinische Verantwortung – und damit ist eine ethische Komponente gegeben – sich auch um die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems, im Interesse der uns anvertrauten PatientInnen, Sorge machen muss.
Wenn dem entsprochen wird, dann sind z.B. bei einer erhöhten Verschreibung von Generika für 6 Präparate – Pantoprazol, Simvastatin, Amlodipin, Quetiapin, Lisinopril-HCT und Citalopram – 50 Millionen € pro Jahr einsparbar (siehe Konsensus Online Newsletter der SV. Nr. 53, Mai 2015). Auch PatientInnen sollten die Zustimmung zur Generikaverwendung als Solidaritätsakt für alle PatientInnen verstehen.
Für die Auswahl bei der Verschreibung von Protonenpumpenblockern (PPI: proton pump inhibitors) ist ein Zitat des Medical Letter 57,91,2015 relevant: „There is no convincing evidence that any one PPI is more effective or better tolerated than any other.“
P.b.b. Erscheinungsort Verlagspostamt 1010 Wien
Montag, 19. Oktober 2015
Pharmainformation
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.
Kontakt:
em.Univ.Prof.Dr.
Hans Winkler
Tel.: +43 (0)512/9003-71200
Fax: +43 (0)512/9003-73200
E-Mail: hans.winkler@i-med.ac.at
Peter-Mayr-Straße 1a
A-6020 Innbruck
Sie finden uns hier.



